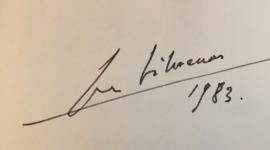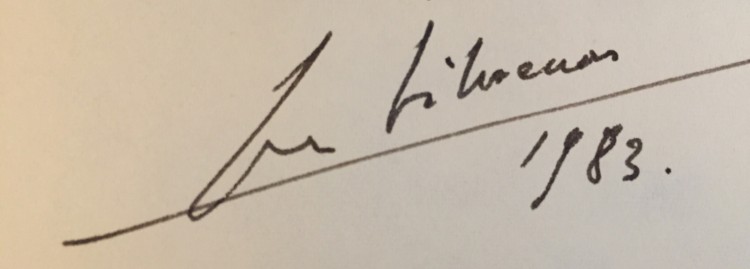
Bildnachweis: Unterschrift - - Bearbeitung: maigret.de
Seite 459
Was für ein Ritt! Nach dem Lesen dieses Kapitel musste ich schauen, ob Simenon wirklich die übliche Seitenzahl »eingehalten« hatte. Geht es anfangs beschaulich um Nachbarn in Lakeville, wechselt Simenon im Verlauf zu seinen Eskapaden in New York und einer Love Boat-Überfahrt nach Europa, um schließlich seine triumphale Ankunft in Frankreich zu beschreiben.
Die Autobiografie liegt hier neben meiner Wohnzimmer-Couch und ich gehe tagtäglich an ihr vorüber. Manchmal sehe ich sie und denke, könntest du ja auch mal wieder schreiben. Aber der Stapel an Themen, den ich habe, wird nicht kleiner. Ständig kommt etwas oben drauf, drängelt sich frech in den Vordergrund, sodass die »Standard« wie dieses Projekt darunter leiden. Aber will ich in den nächsten Wochen mal wieder vorankommen. Und mit diesem Kapitel hat mir es Simenon einfach gemacht: Da gibt es wirklich viele Sachen zu beleuchten, womit ich allerdings nicht die reichlich vorhandenen anzüglichen Szenen im Blick habe.
In der Einleitung geht es weihnachtlich zu. Für den kleinen John war es das erste Weihnachtsfest. Offenbar spendete er bei einem Weihnachtsmann-Besuch beim örtlichen Dies-und-das-Laden nicht dem Santa Claus, sondern einem jungen, blonden Mädchen. Ehe sich die Eltern versahen – beide – war John bei ihr und bedeckte sie mit Küssen. Denen des Mädchens war anzusehen, dass sie es ungehörig fanden. Zeit für ein wenig Erziehungsarbeit, haben sie sich wahrscheinlich gedacht.
Diese wurde auch von Kindermädchen geleistet. Simenon erzählt in diesem Zusammenhang von zweien. Die eine junge Frau war sehr ambitioniert. Simenon mochte sie und wollte nicht, dass sie ein Leben lang von einem Haushalt zum nächsten wechselte – weshalb er sie ermunterte, sich weiterzubilden, eine Ausbildung zu starten. Auch mit ihrer Nachfolgerin kam die gesamte Familie gut aus. Sie hatte ihre Ausbildung schon absolviert und ein Diplom in der Tasche. Der Hausherr hegte den Verdacht, dass sie die Tage mit schlechtem Wetter genoss: Das gab ihr die Gelegenheit, in einem Schaukelstuhl zu sitzen und Fernzusehen, während der kleine Junge vor ihr mit seinem Spiel beschäftigt war.
Nachts hatte der Junge sein eigenes Programm: Er passte die passenden Momente ab, um loszukrähen. Die Eltern hatten ein Intercom installiert und waren sofort informiert, wenn dem jungen Mann etwas fehlte. Meist wollte er etwas vorgesungen bekommen oder er hatte in die Windel genässt. Er schien das Lied sehr zu mögen, was ihm Simenon vorsang. »Ch'val de bois, bois, bois…« ging es los, und nach einem Weilchen »Tourne, tourne, tourne, tourne ...« und dann wiederholte es sich. John mochte Wiederholungen, auch gern mehrmals die Nacht. Was das Lied angeht, dass Simenon in der Vendée lernte – es scheint, er hat es in einer sehr rudimentären Form gesungen. Eigentlich hat es mehr Text, wenn auch nicht herausfordernd mehr. Wichtig ist aber nur, dass es geholfen hat.
Was die nächtlichen Eskapaden anging, hatte der Vater den Eindruck, dass der Kleine wusste, wann er die Eltern richtig stören würde (beim Essen, beim Sex, …) und er die Störungen mit ein wenig Pipi zu »garnieren« wusste. Der Sohn schien, so betonte Simenon in seinen Erinnerungen, immer welches parat zu haben.
Marc wird in dem Kapitel ebenfalls erwähnt: Er pflegte auf der Shadow Rock Farm einen eigenen Zoo. Wahnsinnig gern war er mit seinem Freund in einem Baumhaus auf dem Grundstück gewesen. Ein Abstieg aus diesem erfolgte nur, wenn es notwendig war … beispielsweise um Eiscreme zu holen.
Begegnung beim Friseur
Selbst die, wer im Werk von Schiller wenig bewandert ist, kennt zumindest die Szene, in der Vater Tell auf einen Apfel auf dem Kopfe seines Sohnes schießt. Diese Konstellation war kein Geistesblitz des deutschen Star-Dichters, sondern existierte zuvor schon seit Jahrhunderten in der europäischen Sagenwelt. Spannung ist da nicht mehr, jeder weiß, wie es ausgeht.
Dass es anders ausgehen kann, davon kann der eine oder andere Notfallmediziner und Augenchirurg zu berichten, denn die Szene wird auch gern von ungeübteren Bogenschützen nachgestellt.
James Thurber war sieben Jahre alt und spielte mit seinem Bruder eine Apfelschuss-Szene nach. Ob in diesem Alter literarische Aspekte im Vordergrund standen, daran kann man durchaus Zweifel haben. Vielleicht war es auch nur eine »Ich schieße dir was vom Kopf. Mal schauen, ob das gut geht«-Situation. Und sie ging nicht gut aus. Der Pfeil flog ins Auge, was der Bursche durch diesen verlor und später dazu führte, dass er fast komplett erblindete.
Körperliche Aktivitäten fielen damit weg. Manche(r) wäre angesichts dessen nicht unglücklich, für den jugendlichen Thurber bedeutete es, dass er keinen Uni-Abschluss bekam – für diesen war ein Kurs für das Reserve Officers' Training Corps vorgeschrieben, an dem er nicht teilnehmen konnte. (Die Universität gab ihm den Abschluss 1995, da war der Mann schon 34 Jahre tot.)
Erst arbeitete Thurber für das Außenministerium, später in der amerikanischen Botschaft in Paris. Als er 1920 in die Staaten zurückkehrte, fing er als Reporter bei der Zeitung »The Columbus Dispatch« an. Einige Zeit der 1920er-Jahre verbrachte er nochmals in Paris, diesmal als Reporter und schrieb unter anderem für die »Chicago Tribune«. Sprache und Gewohnheiten dürften ihm damit vertraut geworden sein.
Zurück in den Staaten ging es nach New York. Nachdem er eine Reporter-Stelle bei der »New York Evening Post« angenommen hatte, kam er über einen Freund 1927 zum »New Yorker«. Das sollte seine Heimat werden. Erst schrieb er für die Zeitung, später wurden auch Zeichnungen von ihm veröffentlicht. Die Erste wurde 1930 publiziert, nachdem ein Freund diese in einem Mülleimer gefunden hatte. Um sie aufzupeppen, hatte dieser die Zeichnungen koloriert – später bedauerte er dies zutiefst.
James Thurber arbeitete ebenso schriftstellerisch für den »New Yorker«, dem 1925 gegründeten Magazin. Dieses hatte sich dem feinen Humor verschrieben. Es wurde mehr als ein Witzblatt: Bald war es ein angesehenes Wochenmagazin, in dem Reportagen, Essays und Poesien zu finden waren. Und Geschichten, die Thurber für das Blatt schrieb.
Simenon erwähnt den Namen nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er just diesen Thurber beim Friseur traf, ist nicht gering:
Anhand dieser wenigen Daten von Simenon wäre er schwer zu identifizieren gewesen, aber dankbarerweise gab es noch ein wenig mehr Information:
Ich erfuhr, dass er fast blind war. Es blieb ihm jedoch genug Sehkraft, um seine Zeichnungen zu machen, die, in Bänden zusammengefasst, Bestseller wurden, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in Kanada und England. Er gehörte der kleinen Truppe an, die nach dem Ersten Weltkrieg die New Yorker gegründet hatte.
Gut, dass erwähnt wurde, dass der Mann blind war. So viele Cartoonisten, die nicht richtig sehen können, gibt es bei einer Zeitschrift üblicherweise nicht. (Obwohl bei der Recherche noch ein Weiterer genannt wurde, der aber nur farbenblind war. Dessen Frau übernahm das Kolorieren der Zeichnungen.) Ich betrachte es als Ablenkungsmanöver, dass Simenon schrieb, der Mann wäre einer der Gründer des Magazins gewesen. Das war Thurber definitiv nicht. Aber Erfolg hatte er. Wer in seinem Gedächtnis kramt und nicht in der amerikanischen Literatur bewandert – was für mich beispielsweise zählt – kann trotzdem mit ihn Kontakt gekommen sein. Der vor etwa zehn Jahren erschienene Film »Das erstaunliche Leben des Walter Mitty« basiert auf einer Geschichte des Autors. Aktuell gibt es keine deutschsprachigen Übersetzungen, im besten Fall sind Werke von ihm antiquarisch erhältlich.
Die beiden Männer wurden Freunde – es wundert ein wenig, dass Simenon seinen Namen nicht erwähnte. Ist ja nicht so, dass er an anderer Stelle mit dieser Information geizen würde.
Dieses Unspezifische Simenons trieb mich in dem gleichen Abschnitt fast zum Wahnsinn. In den Fokus der Erinnerungen rückte ein Mann, dessen Vater man laut Simenon als den »König des Kaugummis« bezeichnen könnte. Mir fiel auf Anhieb eine Marke ein, die diesen Status erlangte, konnte aber weitere identifizieren, die ebenfalls sehr populär waren. Dumm nur, dass die Familiengeschichte, die dazu von Simenon erzählt wird, weder zu der einen Unternehmerfamilie passt noch zu einer der anderen. Dass ich herausbekomme, wer der Nachkomme mit einem edlen Charakter ist, der in seiner Freizeit einer alten Frau die Wohnung aufräumte oder Porsche fuhr, war, ist derzeit ausgeschlossen. Dafür weiß ich nun einiges über die Familien Wrigley, Mars (hätte nie gedacht, dass es ein Familienname ist) und über Sammelkarten.
Eiscreme und Schmuck
Das ist ein Text nach meinem Geschmack. Zum zweiten Mal kann ich Eiscreme erwähnen. In Texten wie diesen hat das Seltenheitswert. Wie kommt's?
Simenon erzählt, dass er auf Tahiti Tigy einen Opal gekauft hatte, der der berühmten Sängerin Melba gehört hat. Zur damaligen Zeit kannte man die Frau, aber heute? Die meisten werden die Assoziation mit dem Eisbecher herstellen, und wenn gefragt wird, was es mit dem »Melba« auf sich hat, vermutlich mit den Schultern zucken und sie ein solchen vor sich haben, lieber den Löffel zücken. Korrekt weist Simenon darauf hin, dass es sich um eine australische Sängerin handelte. Ihr Künstlername war inspiriert von ihrer Geburtsstadt Melbourne, eigentlich hieß sie Helen Mitchel, nach ihrer Heirat Helen Porter Armstrong.
Ihr Stimmumfang war spektakulär. Stimme hatte sie schon in Australien, aber ihr Studium absolvierte sie in Paris. Ihr Debüt gab sie in Brüssel, bevor sie ihre ersten Auftritte im Royal Opera House Covent Garden hatte, das wie eine Heimat für sie werden sollte. Hier startete ihre Weltkarriere. Opernliebhaber konnten sie anfangs noch in Sankt Petersburg und auch in Paris hören, später konzentrierte sie sich auf drei Wirkungsstätten: Die Mailänder Scala, die Metropolitan Opera in New York und – wie schon erwähnt - das Royal Opera House Covent Garden.
Sie gilt als erste Primadonna der Welt. Das, was heute häufig abwertend gemeint ist, war damals ein Ehrentitel. Als die Dame in London gastierte, gab der Herzog von Orléans eine Dinnerparty im Hotel Savoy. Ihr wurde ein Dessert überreicht, in welchem über Vanilleeis frische Pfirsiche drapiert und eine auf dem thronte eine Eisskulptur eines Schwanes, welches eine Anspielung auf die Oper war, in der sie aufgetreten war.
Diese Leckerei wurde von Auguste Escoffier erfunden. Ein paar Jahre später änderte er die Rezeptur leicht, gesüßtes Himbeerpüree wurde Teil des Desserts, nannte es Pêche Melba und servierte es an seiner neuen Wirkungsstätte, dem damals jüngst eröffneten Ritz Carlton in London. Die aufwendige Eisskulptur gehörte nicht mehr zum Ensemble, womit der Weg in die lokalen Eisdielen frei gemacht worden ist. Viel Hoffnung, dass es sich bei den Pfirsichen um frische Früchte handelt, sollten sich Eisliebhaber heutzutage auch nicht machen.
Die ersten Begegnungen mit der Küche hatte der junge Auguste Escoffier in der seiner Oma. In der Nähe von Nizza geboren, begann er ab mit seinem 13. Lebensjahr eine Lehre im Restaurant seines Onkels. Nach dieser wechselte er in ein Hotel in Nizza und wurde Chefkoch. Von dort ging er ins »Petit Moulin Rouge« in Paris, wo er erst für die Braten und später für die Saucen zuständig war. Seinen Wehrdienst absolvierte er nicht mit einer Waffe in der Hand, sondern mit einer Kelle als Küchenchef des Generalstabs. Dummerweise geriet er in Kriegsgefangenschaft und bekochte erst die Deutschen (in Wiesbaden) und später für einen französischen General, der ebenfalls in Kriegsgefangenschaft geraten war. Nach seiner Freilassung kochte er in verschiedenen Restaurants im Angestellten-Verhältnis, bevor der 1876 in Cannes sein erstes Restaurant eröffnet.
Aber er kochte auch wieder für andere, sowohl in Paris wie auch in Boulogne-sur-Mer und in Monte Carlos. In der Zeit machte er sich nicht nur Gedanken über ausgefallene Rezepte – Escoffier prägte die Haute Cuisine –, sondern er organisierte auch die Arbeit in der Küche um, in einer Form, wie sie heute noch praktiziert wird. Er hatte nicht nur den Pfirsich in eine neue Dessertform gebracht, der Birne widmete er sich ebenso: 1870 entstand diese Rezeptur und wieder war Kultur mit im Spiel. Birne Helene (französisch klingt es viel eleganter: Poire belle Hélène) wurde von ihm anlässlich der Aufführung der Offenbach-Operette »Die schöne Helena« in Paris konzipiert.
Ist der Mann – jenseits seiner beiden Desserts – aus der Küche heute wegzudenken? Nein. Schließlich hat er sein Wissen in dem Fachbuch »Le Guide Culinaire« zusammengeschrieben und dies gilt heute noch als Referenz in der höheren Küche.
Es ist leicht, zu sehen, wie man mich vom rechten Pfad abbringen kann: Eiscreme.
In New York wollte Simenon seiner zweiten Frau ein schönes Schmuckstück kaufen. Offenbar hatte er dabei eine Vorliebe für Gebrauchtes, denn das gewählte Stück hatte ebenfalls eine Prominente als Vorbesitzerin. Er schreibt in seinen Memoiren dazu:
Es handelte sich um einen Brillanten, also nicht gerade billigen Tinnef. Die Besitzerin dürfte einigermaßen vermögend gewesen sein oder jemanden gekannt haben, der reich war. In diesem Fall könnte es sein, dass es eine Kombination aus beidem war. Bei der Person, die Simenon gemeint haben könnte, handelt es wahrscheinlich um Jean Peters und die Dame war keine Sängerin sondern vielmehr eine Schauspielerin. Peters war eine Freundin von Marilyn Monroe und etwa zur gleichen Zeit aktiv. Sie sollte als Star aufgebaut werden. Sie gewann einen Schönheitswettbewerb in Ohio und wer die Fotos von ihr sieht, der weiß auch, warum.
Der Knackpunkt, weniger für sie als vielmehr für ihr Studio, war, dass sie keine Lust hatte, als Sexsymbol verkauft zu werden. Peters bevorzugte die Rolle, in denen sie einfache und bodenständige Frauen spielte. Gegenüber ihrem Arbeitgeber trat sie sehr bestimmt auf, sie wusste, was sie wollte – das tat sie nicht als Diva oder von oben herab. Ein Biograf von ihr sprach nicht nur Kollegen über die Schauspielerin, sondern auch mit vielen anderen Menschen, die mit ihr persönlich oder beruflich begegnet waren und war erstaunt, dass er nie ein einziges böses Wort oder eine miese Geschichte über sie hörte.
So wenig Starallüren sie am Set hatte, in der Öffentlichkeit wurde sie kaum erkannt. Sie verhielt sich, so wird ihr nachgesagt, nicht wie eine bekannte Schauspielerin. In ihrer Filmografie sind neunzehn Produktionen für das Kino verzeichnet. Das ist nicht besonders viel, aber der ganze Trubel ging ihr gehörig auf die Nerven, entsprach nicht dem Naturell von Jean Peters.
Dass sie nach diesem vergleichsweise kleinen Œuvre mit 29 Jahren schon in den Ruhestand ging, hat sicher auch mit einer Beziehung zu tun, die sie einging. Howard Hughes hatte sich in sie verguckt und die beiden heirateten, nachdem sie sich viele Jahre kannten.
Hughes war reich, das war ihm in die Wiege gelegt worden. Als junger Mann war er erfolgreich im Filmgeschäft tätig und mehrte sein Vermögen, dann entdeckte er sein Faible für das Fliegen und gründete Unternehmen, um Flugzeuge zu bauen. Mit einer Vorliebe für Gefährte, die ihm Rekorde in diversen Flugdisziplinen gaben. Das ging nicht immer glatt, um es wohlwollend zu formulieren. Seine Gewohnheiten zu dem Zeitpunkt, zudem er Peters heiratete, lassen sich exzentrisch nennen. Mit dem Alter wurde es nicht besser.
Einiges schleppte der Mann wahrscheinlich schon immer mit sich rum und als reicher Mensch kann man sich diese auch leisten, zum Beispiel mochte er seine Eier nur in einer Form zubereitet wissen und er soll als Gemüse nur Erbsen gegessen haben, aber nur die kleinen. Andere Marotten erwarb er als Folge von zahlreichen Flugunfällen, die ihm ein schmerzhaftes Leben bereiteten. Die Zeit, in der er mit Peters verheiratet war, verbrachte er häufig allein in dunklen Räumen, nackt, Filme schauend. Er ließ sich nur noch einmal im Jahr die Haare und Fingernägel schneiden – der Grund hierfür wird auch in den Schmerzen gesehen, die er hatte und die er mit den zahllosen Schmerzmitteln nicht mit in den Griff bekam.
1971 ließ sich Peters von Hughes scheiden. Gesehen hatten sie sich zu diesem Zeitpunkt schon Jahre nicht mehr, sie hatten nur noch miteinander telefoniert. Auf Ansprüche aus dem Vermögen von Hughes Nachlass – der Mann war mehrere Milliarden Dollar schwer – verzichtete die ehemalige Schauspielerin. Es gab eine Unterhaltszahlung von etwa 70.000 Dollar im Jahr zu, damit war das Kapitel abgeschlossen. Und wie schon in ihren Hochzeiten als Schauspielerin blieb sie auch bei dieser Episode fern von den Medien und der Öffentlichkeit. Von ihr gab es keine Storys über ihren Ex-Mann und die Trennung – obwohl das Publikum das brennend interessierte.
Sie heiratete einen Manager einer Film-Produktionsfirma und starb im Oktober 2000 in Kalifornien zwei Tage vor ihrem 74. Geburtstag.
Das heißt wiederum, dass sie zu dem Zeitpunkt, zu dem Simenon seine Erinnerungen schrieb, etwas über fünfzig Jahre alt war – »sie war alt« ist wenig charmant. Das mit der »Vergessenheit« stimmt nur halb, schließlich trat sie in einigen wenigen Fernsehproduktionen auf und fünf Jahre, bevor Simenon seine Memoiren verfasste, starb Hughes (unter etwas mysteriösen Umständen), in der Berichterstattung über dessen Tod dürfte die Schauspielerin ebenfalls eine Rolle gespielt haben.
Intimes
Da habe ich ein Weilchen gebraucht, ehe ich kapierte, was Simenon mit diesem Satz meinte. Er nahm Bezug darauf, dass es Orte gab, in denen Prostitution erlaubt war und viele andere, in denen die Polizei angehalten war, dieses als Delikt zu verfolgen. In den Städten, so meine Lesart, gab es Callgirls und deren Nummern wurden unter der Hand weitergegeben.
Simenon kam auf dieses Thema, weil er sich an einen Nachmittag im Hotel erinnerte, es regnete, er hatte nicht zu tun – da schlug ihm Denyse vor, er könne ja ein Callgirl ausprobieren, von dem sie die Nummer bekommen hatten. Warum nicht, dachte sich der Mann, und kam später wieder, ein wenig enttäuscht: Es hätte sich um eine Kanadierin aus dem französischen Teil, klein und dunkelhaarig gehandelt. Ausprobiert hatte der Franzose dieses Abenteuer, aber er stellte später fest, dass er es hätte auch im Hotelzimmer haben können – das Callgirl war so etwas wie eine Kopie seiner Ehefrau.
Die Überfahrt nach Europa erfolgte mit der »Île de France«. Denyse hatte eine französische Linie gewählt, da der Komfort auf den Schiffen dieser besser wäre. Simenon konnte alte Bekanntschaften pflegen, zum Beispiel gab es ein Wiedersehen mit Charles Boyer.
Es bot sich zudem die Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen, auch solche, die an speziellen Verhältnissen mit dem Schriftsteller und seiner Frau interessiert waren. Da wäre die von Simenon Comtesse genannte Person, die sich immer allein zeigte, weil ihr Mann die Einsamkeit vorzog. Nach einem Dinner und einigen Annäherungsversuchen ihrerseits lud er sie in die Kabine der Simenons ein und es gab einen Dreier. Er beschreibt sein Kommen. Der letzte Satz in dem Absatz lautet:
Ein sehr merkwürdiger Abschnitt, wenn ich das mal so formulieren darf.
Ankunft
Die Ankunft Simenons in Frankreich blieb kein Geheimnis und erregte jede Menge Aufmerksamkeit. Die ersten Journalisten wollten den Heimkehrer schon in Plymouth interviewen. Sie waren sehr zeitig an Bord, da hatte das Objekt der Begierde noch keine Lust auf ein Schwätzchen. Er gab ihnen eine Gelegenheit zum Frühstück, meinte später zu Denyse, er hätte nicht viel zu erzählen gehabt. In Le Havre, wo das Schiff letztlich anlegte, »stürmten« dreißig Journalisten an Bord. Simenon war ernsthaft überrascht und Denyse dürfte klar geworden sein, wie populär ihr Mann war. Im Salon auf dem Schiff beantwortete er die Fragen der Journalisten. Auf dem Quai gab es Menschen, die keinen Presseausweis hatten, und seinen Namen riefen. Fangirls und Fanboys – das war auch für Simenon neu.
Für die Zugfahrt nach Paris hatte man der Familie ein eigenes Abteil reserviert. Ein cleverer Journalist des »Le Figaro« nahm Simenon im Zug beiseite und bugsierte ihn in ein leeres Abteil. Dann erklärte er, er wolle ein langes Interview haben – bis Paris unterhielten sich die beiden. Gern hätte ich herausgefunden, um wen es sich handelt. Die Attribute, die Simenon beschreibt – klein, blond, intelligent wirkend, später ein erfolgreicher Schriftsteller – sind sehr prägnant. Aber ohne ein Zugriff auf das Archiv der Zeitung wird sich die Frage nicht klären lassen. Den Biografen Simenons war dieses Rätsel keine Zeile wert.
Die Feier ging in Paris weiter: Begrüßung durch seine Verleger-Garde, eine Suite im »Claridge« und ein großer Empfang im Hotel mit Simenons alten Freunden. Man ist geneigt zu sagen, es geht doch, der Mann kann sich an Namen erinnern, wenn man die Liste liest:
Später dann …
Ein Freund Simenons, Paul Colin, hatte eine Gruppe alter Kumpel in seine Wohnung am Montmartre eingeladen. Der Name hört sich sehr gewöhnlich an, aber Simenon gibt einen Hinweis – der Mann gehörte zu den Stammgästen an der Place des Vosges. Damit war er schon im Erwachsenen-Alter in den 1920er-Jahren und zugleich in Paris.
Das trifft auf einen 1892 geborenen Grafiker zu, der sich auch als Bühnenbildner betätigte. Irgendwie hatte es ihn nach Paris verschlagen und durch einen alten Freund bekam er eine Anstellung als Plakat-Maler und Dekorateur bei »Théâtre des Champs-Élysées«. 1925 wird er damit beauftragt, das Plakat für eine Show namens »Revue nègre« zu konzipieren. Bei den Proben darf er der Musik von Sidney Bechet lauschen, der tänzerisch von dreizehn Tänzer:innen begleitet wird. Ein Star der Revue, die am Broadway startete, bevor sie nach Paris gebracht wurde, wollte nicht nach Frankreich, weshalb die gerade 18-jährige Josephine Baker ihre Chance bekam. Die beiden wurden ein Liebespaar. Nach der Trennung wurden sie Freunde – womit man eine Erklärung hätte, warum Colin Teil der Simenon-Clique wurde. Möglich wäre ebenso, da der Mann sich als Maler betätigte, dass er über Tigys Freundeskreis in zum Gast am Place des Vosges wurde.
Josephine Baker selbst könnte zu der Zeit ebenfalls in Frankreich gewesen sein, nachdem sie die Jahre zuvor in den USA gewesen war. Simenon erwähnt sie in seinen Erinnerungen an den Besuch in Paris jedoch nicht.
Stattdessen berichtet er davon, dass sich Denyse mit Maurice Garçon anlegte. Sie bedachte ihn mit einer spitzen Bemerkung. Die Umstehenden wie auch Garçon selbst waren ob der verbalen Attacke überrascht, denn alle wussten, dass der Mann das nicht auf sich sitzen lassen würde. Er war ein großer Anwalt, der die Fähigkeit hatte, die Geschworenen von seiner Meinung zu überzeugen (was er erfolgreich praktizierte, bis den Geschworenen Berufsrichter bei der Entscheidungsfindung an die Seite gestellt wurden).
Eine ganze Reihe spektakulärer Fälle wurden von ihm angenommen, wie zum Beispiel die Affäre um den Tod von Paul Grappe, der von seiner Frau erschossen wurde. Grappe war 1914 zweimal im Krieg verwundet worden. Ein Offizier vermutete eine Selbstverletzung und zeigte den Korporal an. Daraufhin desertierte er und wurde von einem Militärgericht zum Tode verurteilt – das Beispiel sollte schließlich keine Schule machen. Gruppe lebte als Frau unter dem Namen Suzanne Langdard. Dieses Zusammenleben war für die Ehefrau kein Zuckerschlecken, zumal er einen Hang zu einem ungezügelten Sexualleben entwickelte. Nun mag man der Meinung sein, dass sich so etwas mit Anonymität nicht gut verträgt – da täuscht man sich jedoch. Die Urteile wurden aufgehoben und Grappe konnte das Leben als Untergetauchter verlassen. Seine Geschichte wurde von den Medien aufgegriffen und aus der Kombination aus Freiheit und einer gewissen Bekanntheit kam der Ex-Flüchtige nicht zurecht. Grappe wurde Alkoholiker und gewalttätig gegenüber seiner Frau. Bei einem Streit erschoss sie ihn. Nur die Verteidigung durch Maurice Garçon rettete sie vor einem Schuldspruch.
Garçon begeisterte sich für den Teufel, interessierte sich für schwarze Magie und Literatur. Die Reihenfolge scheint ein wenig beliebig zu sein, aber bei dem Rechtsanwalt handelt es sich um den Beistand von Simenon, als er 1932 wegen Verleumdung verklagt wurde. Die Klägerin behauptete, sie wäre in dem Roman »Tropenkoller« (frz.: »Le Coup de lune«) als Prostituierte verunglimpft worden.
Ein wortgewandter Mann, wie er, der Mitglied in einem Konservatorium für Humor war, freute sich wahrscheinlich darauf, die unbedarfte Ehefrau eines Freundes zu piesacken. Wer austeilt, der muss einstecken können – das war Denyse nicht gegeben. Aus dem Text lässt sich nicht erschließen, ob es ein einzelnes Wortgefecht war oder eine Serie. Am Ende war Simenons Ehefrau sprachlos, brach in Tränen aus und verschwand.
Der Gastgeber tröstete sie. Als sie nach einem Weilchen wieder herauskam, hatte sie ihr Gesicht bemalt, ihr Haar mit einer Feder bestückt und lief in einer Decke gehüllt raue Schreie ausstoßend durch das Wohnzimmer. Sie bekam, beschreibt Simenon, höflichen Applaus. Wofür eigentlich?
Am Rande bekommen die Leser:innen noch mitgeteilt, dass sich Simenon für Ente à l'orange und Steinbutt Dugléré begeistern kann. Nicht so schön war wohl, dass er die Gerichte während seines Besuchs fast jeden Tag auf dem Tisch standen. (Ich komme nicht drumherum, noch zu erwähnen, dass es sich bei Dugléré um einen französischen Meisterkoch handelte, der nicht nur Fischrezepten seinen Namen verpasste, sondern auch Pommes Anna – wobei es sich nicht um ein Dessert geht, sondern um die Pommes de terre, sprich Kartoffeln.) Diese beiden Gerichte wurden beim Empfang samt Mittagessen auf der Polizeipräfektur serviert – wieder einmal. Simenon bekam dort eine silberne Kommissarmarke verliehen, die den Namen Maigrets trug. Eine Ehrung durch den Pariser Polizeipräfekten, die in Anwesenheit der Kommissare stattfand.
Das volle Programm des Schriftstellers beinhaltete die Teilnahme an einer Veranstaltung, die dem berühmten »Bal anthropométrique« nachempfunden war. In bescheidendem Umfang, aber diesmal war auch der Präfekt anwesend. Vier Tänzerinnen waren auch engagiert worden, und mit zweien von ihnen hatte er bei der Gelegenheit auch Sex.
Das kann man wohl sagen. Zwischendurch ein kleiner Abstecher nach Monte Carlo und nach Rom. Bevor es nach Lüttich gehen sollte.
Zuhause
Simenon hatte sich vorgenommen, die Journalisten und Offiziellen auszutricksen. Einen Tag früher, als das geplant war, fuhr er mit Denyse in seine Heimatstadt. Ohne großen Tross im Schlepptau wollte er ihr seine Heimat zeigen – wo er gewohnt hat, wie er zur Schule gegangen hat. Sachen halt, die man als Fünfzigjähriger einer Eroberung zeigt, die nicht aus der gleichen Gegend kommt wie man selbst.
Es sollte ihm nicht gelingen. Ein Reporter des »Match« hatte entweder Wind davon bekommen, ein gutes Näschen oder war dem Schriftsteller auf der Reise einfach gefolgt. Simenon anonym in Lüttich unterwegs – das waren sicher tolle Fotos. Der kleine Reporter – Daniel Filipacchi – sollte eine eigene Nummer werden, ein Tausendsassa.
Der Jazz-Liebhaber bekam die Gelegenheit, zum Tod von Charlie Parker eine Radio-Sendung zu moderieren. Diese Hommage war derart erfolgreich, dass Filipacchi mit seinem Freund Frank Ténot für eine eigene Show angeheuert wurde, die jeden Tag ausgestrahlt wurde. Die Kompetenz war vorhanden, warum also nicht eine Zeitschrift zum Thema Jazz übernehmen. Das war der Einstieg ins Verlagsgeschäft, zu dem auch noch sein Engagement im Event-Bereich kam: Er organisierte Tourneen von Jazz-Musikern wie Louis Armstrong, Duke Ellington, Ella Fitzgerald und anderen. Kann sich jemand vorstellen, was als Nächstes kam? Richtig, ein Plattenlabel.
Nebenbei moderierte Filipacchi im Radio Sendungen zum Thema Rock'n'Roll und dies derart erfolgreich, dass es sich lohnte, eine Zeitschrift zur Sendung zu gründen. In seinem Verlag sollten die verschiedensten Zeitschriften publiziert werden – von den Männermagazinen »Lui« (sowie die französischen Ausgaben von »Playboy« und »Penthouse«) über Teenager-Magazine bis hin zu Fachmagazinen. Zu dem Portfolio zählte alsbald auch »Paris Match«, welches er erfolgreich auf Kurs brachte. Mit seinem Freund Jean-Luc Lagardère kaufte er 1981 die Hachette-Zeitschriften-Gruppe auf und so gesellten sich in das Verlagsprogramm an Publikationen Fernsehzeitschriften und die bekannte »Elle«.
Damals war Filipacchi noch eine kleine Nummer, der sich freute, ein schönes Bild von Denyse und Georges in Lüttich zu schießen … das erste.
Seine Geheimhaltungsaktion hätte aber auch so nicht geklappt. Zwei junge Mädchen entdeckten den Schriftsteller beim Eisessen und erkannten ihn. Er war ein Onkel oder Großonkel von ihnen – zumindest die Familie würde bald Bescheid wissen.
Und wieder Eiscreme …


 Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.
Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.