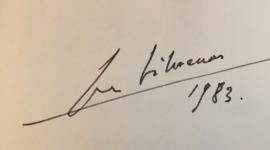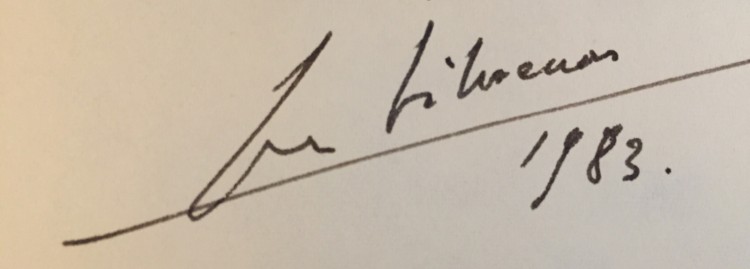
Bildnachweis: Unterschrift - - Bearbeitung: maigret.de
Seite 434
Die Scheidung von Tigy war erst vor kurzer Zeit rechtsgültig geworden. Simenons finanzieller Spielraum war durch die mit seiner Ex-Frau geschlossenen Vereinbarungen eingeengt. Er selbst schreibt, dass er zu dem Zeitpunkt beinahe mittellos gewesen sei. Bevor die Leser:innen sich zu viele Sorgen machen: Hätte er gejammert, was er nicht tat, wäre das Jammern auf sehr hohem Niveau gewesen.
Um dies kurz einzuordnen: Simenon hatte sich gerade das Haus in Lakeville gekauft, welches zuvor einem Millionär gehört hat. An keiner Stelle bekommen Leser:innen beim Lesen der Schilderung des Anwesens das Gefühl, es könnte sich um eine ärmliche Unterkunft gehandelt haben. Das Geschäft konnte, das ist korrekt, nur dank einer Hypothek einer Bank abgewickelt werden. Auch wenn man heute hin und wieder das Gefühl bekommen könnte, dass Kreditinstitute das Geld zum Verleihen jedem hinterher schmeißen, so darf man sich sicher sein, dass sich an der großen Linie dieser Firmen – »Wir geben Geld an Menschen, die welchen haben.« – nicht geändert hat. Das galt ebenso für den Autokauf Simenons in New York – das Gefährt hätte er in bar bezahlen können, aber er kaufte es auf Pump. Und bei der Fast-Mittellosigkeit Simenons war es immer noch so, dass er für den Weg von West nach Ost ein Flugzeug wählte, was zur damaligen Zeit kein Massentransportmittel gewesen ist, und in Big Apple nicht in günstigen Hotels absteigen musste, sondern in Luxushotels.
Den ganze Krams, den Simenon mit sich rumschleppte, nun von Kalifornien wie aus Arizona nach Connecticut zu bringen, war ebenso ein kostspieliges Vergnügen. Wir hatten in den vorangegangenen Kapiteln ja erfahren, was für Extravaganzen Simenon aus Europa nach Amerika expediert hatte. Er selbst erwähnt seine Bücherkisten, ich kann mir aber gut vorstellen, dass zu diesem Archiv auch Zeitungs- und Zeitschriften-Artikel gehörten. Viele, viele Kilos, die transportiert werden wollten.
Dafür, dass sie das Haus leer übernommen hatten, war es im September ein wohnlicher Ort. Simenon schrieb von einem Wunder und listet bei der Gelegenheit eine Reihe von Ereignissen auf, die er in der Vergangenheit auch in diese Schublade packen würde.
Persönlich würde ich das nicht tun, denn Wunder sind unverhofftes Glück, an dem man keinen wesentlichen Anteil hat. Das würde ich bei diesen Ereignissen nicht so sehen, denn letztlich waren sie immer mit Arbeit verbunden – entweder der von Simenon oder der von Tigy. In den Schoß war ihnen dabei nichts gefallen: Die einzige Ausnahme dürfte die Anstellung Simenons beim Grafen von Tracy gewesen sein, bei der ihm nur half, dass er zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle gewesen war.
Seine Freiheit erlangte er durch den Verkauf von Geschichten – aber wo ist das Wunder? Simenon schrieb sie und er hatte für die Qualität zu sorgen. Der Verkauf eines Bildes erlaubte ihnen die Entdeckung von Porquerolles – aber dazu musste es von Tigy erst gemalt werden. Die Groschenromane von Simenon gaben ihnen die Möglichkeit, ein Boot zu bauen und zu reisen – haben sich die Geschichten selbst geschrieben? Ich glaube, Simenon hat es immer verstanden, das Leben zu genießen. Keine Frage! Jedoch nichts fiel ihm einfach in den Schoß. Er hatte dafür zu arbeiten – und so schreibt er, ich komme darauf zurück, dass er früh zu Bett ging; wie er einige Kapitel zuvor erwähnte, dass er früh aufstand, um zum Schreiben.
Nun, da er knapper bei Kasse war, sollte sich einer jener glücklichen Zufälle ereignen, die das Leben so angenehm machen können. Bei Simenon kamen die immer dann, wenn Herrschaften aus der Film-Industrie entdeckten, dass Geschichten von ihm verfilmbar waren.
Einige Romane wurden bis zu dreimal im selben Land oder im Ausland verfilmt. Wie kurz vor deiner Geburt, Marc, Monsieur La Souris, bereits von meinem Freund Raimu auf Französisch gedreht, dann von dem besten Komiker Englands jenseits des Ärmelkanals.
Die Raimu-Verfilmung von »Monsieur La Souris« interessiert mich immer noch und ich hoffe, dass die verfügbare Synchronisation eines Tages nochmals zur Aufführung schafft (aber diese Hoffnung habe ich für diverse alte Filmwerke, gerade mit Verbindungen zu Simenons Werk). Die französische Adaption liegt mir am Herzen, da sie verbunden ist mit der einzigen deutschen Ausgabe des Romans, welcher zum letzten Mal von 35 Jahren erschien, und bei der eine Szene aus dem Film, das Cover zierte.
Simenon jedoch erwähnte, dass es eine weitere Verfilmung gab und machte sich nicht die Mühen, kurz in sein Archiv zu gehen, um nachzuschlagen, bei wem es sich bei dem »besten Komiker Englands« handeln würde. Der Nachsatz ist gleich in mehrfacher Hinsicht irritierend: Warum fügte Simenon der Formulierung noch das »jenseits des Ärmelkanals« hinzu? Gab es englische Komiker, die zur damaligen Zeit »diesseits des Ärmelkanals« bedeutsam gewesen waren und wenn ja, welcher wäre es gewesen? Das bleibt sein Geheimnis.
Bevor ich zu dem Thema zurückkomme, eine kleine Abschweifung: Ich habe eine französische Ausgabe der »Intimen Memoiren« vorliegen. Diese zwar nur als E-Book, aber für mich ist das sehr praktisch, da ich bei kniffligen Passagen schnell fündig werde und nicht ewig hin und her blättern muss. Ein Unterschied zwischen der französischen und der deutschen E-Book-Ausgabe dieses Werkes ist der, dass die französische mit einer ganzen Reihe von erklärenden Fußnoten daherkommt. So muss der deutsche E-Book-Leser an der Stelle – vom Papier-Leser will ich einmal schweigen – anfangen zu recherchieren, während die Leser, die des Französischen mächtig sind, mit einer Fußnote verwöhnt werden.
In der ist vermerkt, um welchen Film es sich handelt und wen Simenon für den besten Komiker Englands hielt. Auch heute ist das nicht schwierig, schließlich liegt der Aufruf von maigret.de mit den passenden Antworten nicht fern – aber das Buch muss dafür auf jeden Fall verlassen werden. Es heißt immer so schön, dass das Gras auf der benachbarten Weide immer saftiger und grüner ist. Stimmt oft nicht, aber so manches Mal halt doch.
Britische Komiker und Entdecker
Nachdem ich einen Fingerzeig gegeben habe, wie Sie die Information erlangen können, will ich die Lesenden aber trotzdem noch ein wenig auf die Folter spannen. Welches waren die besten Komiker Englands, die damals lebten und arbeiteten? Stan Laurel, Charlie Chaplin, Alec Guiness, Peter Sellers – wären die, die mir einfielen. Letzterer passt nicht so recht in die Riege, da seine Karriere zu dem Zeitpunkt erst anfing und er sich noch keinen Namen erarbeitet haben konnte. Das wären die Schauspieler, die mir als bekannte Komiker der damaligen Zeit einfallen und die auch als Engländer galten.
Simenon meinte jedoch einen anderen Darsteller: Stanley Holloway. Nie gehört, dachte ich mir, als ich den Namen las. Hin und wieder lässt sich das Gedächtnis auf Trab bringen, wenn ich mir eine Zusammenfassung des Werkes anschaue. Da tauchten dann Produktionen auf, wie »Das Privatleben des Sherlock Holmes« (was aber nichts zu sagen hat, es gibt so viele Filme mit dem Detektiv, auch wenn in diesem Billy Wilder die Regie führte) und »My Fair Lady« (8 Oscars, Holloway bekam eine Nominierung als bester Nebendarsteller) – aber selbst diese Durchsicht erzeugte keinen Aha-Effekt. Sein filmisches Schaffen war bis in die 50er-Jahre übersichtlich, womit die Bewertung von Simenon an der Stelle vielleicht retrospektiv ist. Laurel und Chaplin waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von »Midnight Episode«, der englischen Verfilmung von »Monsieur La Souris«, die bekannteren Komiker Englands.
An der Stelle erlaube ich mir einen weiteren Exkurs, einfach weil ich es witzig finde, wie der Zufall manchmal Personen, Orte, Geschehnisse – was auch immer – zusammenbringt: Als wir vor ein paar Jahren an den Victoriafällen standen, gab es dort eine Statue von David Livingstone, ein aus Schottland stammender Forscher. Mir ist nicht ganz klar, was damit gefeiert wird. Vielleicht war es die Tatsache, dass er als erster Europäer diese Wasserfälle gesehen und davon zu Hause berichten konnte. Mir fiele nicht ein, ihm den Titel »Der Entdecker der Victoriafälle« zu geben, wie es eine Dokumentation der ARD tut, da ich davon ausgehen würde, dass den Einheimischen zuvor aufgefallen war, dass sich dort Wasserfälle befanden (genau genommen zeugt die Betitelung von einer erstaunlichen Ignoranz). Es war zu da damaligen Zeit für einen Europäer beschwerlich, dort hinzugelangen – je nachdem, aus welcher Richtung man gerade kam. Wir planen für dieses Jahr einen weiteren Besuch in der Gegend und sind damit in dem Teil von Namibia, der heute Sambesi genannt wird.
Jetzt hat es ein gewisses Unterstatement, wenn man von einer Unterkunft in Namibia behauptet, sie läge abgelegen – schließlich liegen fast alle Herbergen »ein wenig abgelegen«, aber die geplante Unterkunft liegt wirklich sehr abseitig. Auf dem Weg dorthin – im absoluten Nirgendwo – gibt es aber ein kleines Museum, welches David Livingstone gewidmet ist und welches aus einem einzigen Raum besteht. Dass einem solch bedeutenden Reisenden ein Denkmal gesetzt wird, ist interessant und an sich nicht ungewöhnlich. Der Mann hatte sich aber mit der Entdeckung der Victoria Falls, die für sich schon ein Traum sind und in einer Gegend liegen, in welches es sich gut aushalten lässt, so ein Faible für warme Temperaturen vorhanden ist, nicht zufriedengegeben und wollte weitere Entdeckungen vornehmen. Die nächsten dreißig Jahre war Livingstone damit beschäftigt, weiter auf dem Kontinent zu forschen und seine Erkenntnisse in seiner Heimat zu verbreiten. So schön Afrika auch ist, so gefährlich ist der Kontinent und für die Gesundheit, gerade damals, war es sehr fordernd. Auf die sechzig zugehend startete Livingstone eine weitere Forschungsreise, die ihn ins Manyemaland führte und hing mit seinen Post-Angelegenheiten etwas hinterher. Da keiner etwas von ihm gehört hatte, wurde eine Expedition finanziert, die Livingstone finden sollte. Die Finanzierung erfolgte durch einen amerikanischen Verleger namens James Bennett und der Mann, der die Mission leitete, hieß Henry Morton Stanley.
Der Waliser Stanley hatte keinen guten Start in seiner Heimat gehabt: ärmliche Verhältnisse, der Vater verstarb kurz nach seiner Geburt, seine junge Mutter verließ ihr Baby. Der Großvater mütterlicherseits zog ihn auf, bis er selbst starb und dann kam der Junge bei verschiedenen Verwandten innerhalb der Familie unter. Eine schöne Kindheit war es nicht und einen Grund, in der Heimat zu bleiben, sah der junge Stanley wohl auch nicht. Wo machte man damals sein Glück? Richtig, in Amerika. Auch den Waliser zog es dorthin.
Seine erste Station war New Orleans. Seiner Geschichte nach soll er einen wohlhabenden Händler kennengelernt haben, der keine Kinder hatte und den jungen Mann gern adoptierte. Das ging sicher nicht so Hopplahopp, wie es sich hier jetzt anhört, aber selbst wenn es ausführlicher beschrieben wird, haben sich Historiker daran gemacht und herausgefunden, dass sie gar nicht nachweisbar gewesen war. Fakt ist aber, dass er dann in den amerikanischen Bürgerkrieg verwickelt wurde, als Soldat, und es ihm dabei gelungen sein soll, sowohl in der Armee der Konföderierten, der Unionsarmee wie auch in der Union Navy zu dienen. Dazu existiert die Vermutung, dass er vielleicht der einzige Mensch war, dem das gelungen war.
Nach dem Krieg war er Sonderkorrespondent und eine Art Reisejournalist. Alle Bilder, die einen wie in einem bunten Reisemagazin oder auf Instagram mit schicken Hotels und Autos vor dem geistigen Auge erscheinen, sollten beiseite geschoben werden. Gut vorstellbar, dass sich heutige Influencer auch freuen würden, wenn sie eine Entourage von 192 Trägern hätten (111 waren es tatsächlich), aber es fehlte einiges an Komfort, was einem heutigen Reisenden als unabdingbar gilt. Im März 1871 ging es für Stanley nach Sansibar mit dem Ziel, besagten David Livingstone finden. Unter einem guten Stern stand die Mission nicht: Dem einfachen Volk in seinem Trupp fehlte der Glaube an ihren Chef, weshalb sie sich davon machten. Die, die blieben, erkrankten an landestypischen Krankheiten und fielen so aus. Letztlich fand Stanley den Gesuchten in Tansania in der Nähe des Tanganjika-Sees und soll ihn mit den berühmt gewordenen Worten: »Dr. Livingstone, nehme ich an?« begrüßt haben. Heute haben die Historiker einige Zweifel, ob das Treffen so verlief.
Stanley schloss sich Livingstone an, der die Quelle des Nils suchte. Der Tanganjika-See war es nicht. Stanley kehrte nach Europa zurück und schrieb ein Buch über seine Mission. Den, den er gesucht hatte, der blieb, gab seine Suche nach der Nil-Quelle nicht auf und starb zwei Jahre später mitten in Afrika.
Nachdem er das Buch geschrieben hatte, schmiedete Stanley Pläne für eine weitere Expedition. Die Kartierung der großen Seen und Flüsse sollte abgeschlossen werden und – wie schon Livingstone – wollte auch Stanley die Quelle des Nils finden. Er hatte einen damals einen Fluss identifiziert, der das Zeug hatte, der Ursprung des längsten bzw. zweitlängsten Flusses zu sein. Der Strom sollte ihm den Gefallen nicht tun: Sie folgen ihm neun Monate und dann drehte sich dieser nach Westen und es stellte sich heraus, dass es der Kongo war. In Abenteuer-Filmen werden Expeditionen sterben die Statisten häufig wie die Fliegen. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass dieser Aspekt nicht fern von der Wahrheit ist: Vier Europäer starteten bei dieser Mission. Stanley war der einzige, der am Ende am Leben war. Zu Beginn hatte man 228 Helfer engagiert, von denen 114 am Ende noch dabei waren. Der Rest war tot. Stanley selbst meinte in seinen Aufzeichnungen, dass die Expedition ursprünglich mit 356 Personen gestartet war. Im Unterschied zu jedem Abenteuerfilm dauerte diese Unternehmung fast tausend Tage.
Der Mann galt als Spitzenforscher der damaligen Zeit und machte sich Hoffnungen, dass ihm die Briten weitere Expeditionen finanzieren würden. Aber in London hatte man hässliche Gerüchte gehört: In denen ging es um Morde und Plünderungen. Damit wollte man nicht in Verbindung gebracht werden. Es gab aber jemanden, der hatte weniger Skrupel: Leopold II. – seines Zeichens belgischer König.
Im Juni 1878 unterzeichneten die beiden einen Vertrag. Teil der geheimen Vereinbarung war es, dass entlang des Kongos ein Transportsystem und eine Kette von Handelsposten errichtet würde. Für Stanley ging es darum, weiter Afrika zu erforschen; dem belgischen König war die Ausweitung seiner kolonialen Gebiete wichtig. Es sollten staatliche Strukturen geschaffen werden, wobei für die Herrschaften eine Einbindung der Einheimischen in die staatlichen Strukturen ein alberner Gedanke war – die Macht hatte in den Händen von Weißen zu liegen. Belgiern, wie sich gut denken lässt. Die Verträge, die Stanley mit den Einheimischen abschloss, stimmten den König nicht froh: Der wollte kurze Abkommen, in denen die Stämme alle ihre Rechte abtraten. Trotzdem wurde er vom belgischen König später als Held ausgezeichnet, gar nicht mehr geheim.
Später sollte der Forscher schreiben, dass sein Problem nicht die Arbeit war, die er tat – es wären die Menschen gewesen, mit denen er zu tun hatte. Und Überraschung, er meinte nicht die Einheimischen, sondern die kolonialen Aufseher und Offiziere. Das kommt einem irgendwie bekannt vor, in dieses Horn stieß auch Simenon später in seinen Aufzeichnungen aus den Kolonialgebieten.
Jetzt mag der eine oder andere denken, dass dies der Anknüpfungspunkt ist, den ich zu den »Intimen Memoiren« gefunden hätte. Hätte er sein können, aber ist er nicht. Die Beziehung ist viel trivialer Natur: Der britische Komiker Holloway, ja da kommen wir her!, bekam seinen Vornamen nach dem Afrika-Forscher. Verbindungen persönlicher Natur, die der Vater, ein Angestellter bei einem Rechtsanwalt, oder seine Mutter, eine Schneiderin, zu Stanley hatten, sind nicht bekannt. Es gab einen Schauspieler in der Familie, ein Onkel von Stanley Holloways Mutter – aber prägend war dieser gewiss nicht – er starb, als der künftige Komiker vier Jahre alt war.
Schon früh schloss er sich einem Chor an, eine richtungsweisende Entscheidung, wie es es selbst nannte. Aber erst einmal sollte er eine andere Laufbahn einschlagen: Wer wurde Kaufmann in einer Schuhpoliturfabrik und arbeitete später als Angestellter auf dem Billingsgate Fish Market. Nebenbei sang er als »Wonderful Boy Sopran«. Im Alter von zwanzig Jahren begann seine Bühnenkarriere. Er arbeitete für Varieté-Shows und wurde drei Jahre nach seinen ersten Auftritten von Leslie Henson engagiert. Der gleichaltrige Komiker hatte sich schon einen Namen gemacht, allerdings war er erfolgreicher. Zwischen den beiden entstand eine Freundschaft, die sich gegenseitig ihr Leben lang beeinflussen sollten.
Während des Ersten Weltkriegs organisierte Holloway Shows, mit denen die Truppenmoral gestärkt werden sollte. Nachdem Krieg kehrte er auf die Bühnen und hatte sein erstes Film-Engagement. 1921 schloss er sich einer Revue namens »The Co-Optimists« an, bei der viele Künstler mitspielten, die er während seiner Engagements während des Krieges kennengelernt hatte. Interessant an der Show war, dass man die Skripts regelmäßig in den Papierkorb warf und komplett neu schrieb. Nebenher arbeitete er für die BBC, nahm Schallplatten auf und entwickelte einen Charakter namens Sam Small. Über die kommenden Jahre sollte er zwanzig Stücke für diese Figur schreiben, die er selbst aufführte und die begeistert aufgenommen wurden. Mit dieser Rolle trat er nicht nur im Theater auf, auch drei Filme wurden ihr gewidmet.
Für den Kampf war er mit Beginn des Zweiten Weltkrieges zu alt. Er stelle sich für Propaganda-Filme zur Verfügung. Während des Krieges und danach arbeitete der Schauspieler sowohl für den Film wie auch für das Theater – Holloway war nicht festgelegt. Er spielte in »A Midsummer Night's Dream« beim Edinburgh Festival, eine Produktion, die von der Royal Shakespeare Company im Anschluss nach New York gebracht wurde, bevor eine Tournee in Nordamerika gespielt wurde. Das amerikanische Publikum liebte ihn – 1956 begann er den Alfred P. Doolittle in der Broadway-Produktion »My Fair Lady« zu spielen. In der Zeit kam er auch im Fernsehen an: Er hatte im amerikanischen TV eine eigene Show und trat mit bekannten Größen wie Dean Martin auf. Und dann wären wir auch schon bei der Oscar-prämierten Verfilmung von »My Fair Lady«.
Holloway hatte Rollen in Filmen wie »In Harm's Way«, einem Kriegsfilm an der Seite von John Wayne und Kirk Douglas auf, spielte in einer Adaption von P. G. Wodehouses Blandines Castle-Geschichten mit, die für die BBC produziert wurde, und war weiterhin im Theater zu sehen. Seinen letzten Auftritt hatte er im London Palladium, da war er 89 Jahre alt. 1982 starb er im Alter von 91 Jahren an einem Schlaganfall.
Seine Simenon-Verfilmung wird in seiner Biografie nicht großartig erwähnt. Dort war das Ganze nur ein Nebensatz und die Einrichtung der Shadow Rock Farm wurde nicht durch Monsieur La Souris finanziert, sondern durch den Verkauf der Filmrechte an »La Marie du port« und »La vérité sur Bébé Donge«, die beide mit Jean Gabin verfilmt werden sollten.
Für Ordnung im neuen Haus war auch gesorgt: Tochter und Mutter einer in der Nähe lebenden Familie, letztere stammte von den Antillen, wurden engagiert und schmissen den Haushalt. Es soll sehr fröhlich zugegangen sein.
Der Besuch
Bisher war Simenon seiner Schwiegermutter nur einmal begegnet. Er hatte es nicht weiter thematisiert, dafür nimmt er sich in diesem Kapitel die Zeit, denn kaum waren sie in Shadow Rock eingezogen und die Einrichtung war abgeschlossen, konnten sie die Mutter schon im Flughafen abholen. Simenon war Simenon und nannte die Frau »Mama«, was diese sehr zu irritieren zu schien. Offenbar hatte man Simenon nicht gesagt, dass Kanadier (damals) ihre Schwiegereltern mit »Madame« und »Monsieur« ansprachen … oder es war ihm egal.
Zwischen den beiden gab es einen weiteren Unterschied: Wie zuvor erwähnt, war Simenon Frühaufsteher und diszipliniertes Arbeiten gewöhnt. Die Mutter von Denyse war eine Nachteule. Sie mochte es, lang aufzubleiben, und sich bis in die Puppen zu unterhalten. Es war, das sah Simenon ein, nicht die Gelegenheit, mit einem komplizierten, aufregenden Stück anzufangen. Und so verdanken wir dem Aufenthalt der Schwiegermutter »Maigrets Memoiren«.
Von diesen Gesprächen erwähnte Simenon eine besondere Episode: Denyse hatte ihm von dem Sarg erzählt, in dem ihr Großvater lag. Ein sehr teurer Sarg, mit Silber verziert und er hatte eine Besonderheit, die ihn außergewöhnlich machte. In der Höhe des Gesichtes des Verstorbenen gab es eine Klappe, die geöffnet wurde, wenn Besucher kamen. Sie erlaubte keinen direkten Blick, den man hat ein Fliegennetz eingearbeitet. Simenon hatte von einer solchen Konstruktion nie zuvor gehört und war beeindruckt. Während der langen Gespräche kamen sie darauf zu sprechen und er konnte erkennen, dass seine Schwiegermutter erst irritiert war, eine solche Konstruktion abstritt, bevor sie ärgerlich wurde, da Denyse sich davon nicht abbringen ließ. Sie schloss die Diskussion mit der Tochter mit den Worten »Hör doch auf!«.
Nach den Worten von Simenon sollte er diese Phrase noch häufiger aus dem Munde seiner Schwiegermama hören. Offenbar hatte seine Ehefrau eine lebhafte Fantasie oder Erinnerungen, die von der ihrer Mutter stark abwichen. Ihm schien einiges klar zu werden, was sich in den letzten fünf Jahren ereignet hatte.
Im Dezember Simenon nicht Gastgeber sondern Gast. Er war bei der nahe gelegenen Yale University eingeladen und hielt ein »lecture«. Simenon, der nie eine Hochschule besucht hatte, war begeistert, dass er sein Wissen weitergeben konnte – er musste nicht studiert haben, um ihr Studenten seine Kenntnisse weiterzugeben. Seine Erfahrung hatte er sich durch Praxis erworben und sie wurden hier wirklich geschätzt. Nach der offiziellen Veranstaltung saß er noch mit Lehrer und Studenten zusammen, es wurde gegessen, getrunken – eine sehr, sehr lange Nacht.
Langweilig
Boule war mit der Arbeit bei Tigy nicht ausgelastet oder sie fühlte sich nicht wohl. Sie kam zurück zu Simenon und organisierte den Haushalt in der Shadow Rock Farm.
Langeweile gab es während der Arbeit wahrscheinlich nicht, in der Freizeit sah es für das Personal jedoch anders aus. Lakeville mochte ein beschauliches Plätzchen sein, aber Vergnügungen stand nicht an erster Stelle. Dafür musste man weiter fahren und dafür bot sich New York an. Es war üblich, dass das Personal einmal im Monat eine Woche frei hatte und dann vorzugsweise in die Metropole fuhr. Auch die Simenons hielten es so. Sie stiegen dann nicht im Drake Hotel ab, welches Simenon an der Stelle als »nüchtern« charakterisierte, sondern im Hotel Plazza, ebenfalls am Rande des Central Parks gelegen.
Er berichtet davon, dass im Aufzug des Hotels auf Fernandel stieß. Simenon dazu:
Auch den Namen der Hauptperson, Alavoine, hatte man geändert, da er wegen des berühmten Pferdegesichts des Schauspielers zum Lachen gereizt hätte. Welchen Namen hatten die Produzenten gefunden? Cassegrain!
Hier hat man, das muss ich zur Ehrenrettung der deutschen EBook-Ausgabe zugestehen, erklärende Fußnoten hinzugefügt (die in der aus den 80er-Jahren stammenden Buch-Ausgabe nicht existieren). So erinnerte der Name des Buch-Darstellers an das französische l'avoine, was für Hafer steht und ersetzte es durch ein Synonym für Kornfresser. Nun ja, das wäre in der Tat kein sehr guter Tausch gewesen.
Allerdings hieß die Hauptfigur in dem Film, die von Fernandel gespielt wurde, Dr. Charles Pellegrin.
Simenon schilderte in dem Kapitel, dass er von einem heftigen Schneesturm überrascht wurde. Während der Fahrt musste er immer wieder anhalten, um seine Windschutzscheibe freizumachen. Bis ganz nach Hause kam er nicht, die Brücke wagte er nicht zu passieren. So stapfte er den Rest des Weges. Die Szene erinnert an das erste Kapitel von »Das zweite Leben«, auch wenn diese Episode hier wesentlich besser ausging.
Das Kapitel endet mit einer Schilderung von Weihnachten und dem Kauf einer elektrischen Eisenbahn. Simenon bekam sie nicht zum Laufen, aber dank eines bekannten Elektrikers konnte das Weihnachtsfest gerettet werden. Bis in die frühen Morgenstunden konnten Marc und sein Papa mit der Eisenbahn spielen. Fantastisch!


 Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.
Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.