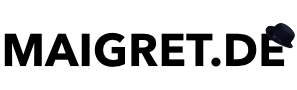mord Inhaltsverzeichnis

Ein Wintergarten anderer Art
Der Glanz vergangener Zeiten ist zu erkennen, wenn man sich Bilder des Berliner Wintergarten Varieté anschaut. Das war ein legendärer Ort – an dem sich traf, was Rang und Namen hatte und in Berlin weilte. Und weil das so war und Simenon ziemlich oft von Orten schrieb, an den schon gewesen war, kann man davon ausgehen, dass er auch den Berliner Wintergarten wohl mal besucht hatte.
Weiterlesen
Die Nacht am Pont Marie
Eine neblige Nacht an der Seine. Zwei Polizisten werden von einer hysterisch wirkenden Frau angesprochen, die behauptete, sie hätte einen Mann umgebracht. Gefunden wurde die Leiche nicht, die Frau kommt auf die Wache. Am nächsten Morgen erklärte sie den Beamten, das wäre ein Streich gewesen, niemand wäre gekillt worden und wollte Hause. Statt schenkelklopfend mitzulachen, gab es ernste Gesichter. Die Frau wurde zum Ufer gebracht und man zeigte ihr einen Leichnam – den von ihrem Ehemann.
Weiterlesen
Madame Smitt
Eines Tages lag ein toter Hund im Garten von Madame Smitt. Sie konnte sich nicht darum kümmern, da sie erkrankt war. Also machte das einer ihrer Pensionsgäste, ein wahrlich netter Mann. Als er nun im Garten ein Grab für das verstorbene Tier grub, stieß er auf Knochenreste. Nicht die eines Tieres, sondern die eines Menschen. Die Untersuchungen ergaben, dass es sich um einen Mann handelte und dass er mindestens fünf Jahre dort gelegen hatte. Richter Froget stattete der kranken Wirtin ein Besuch ab.
Weiterlesen
Monsieur Rodrigues
Richter Froget hatte es in diesem Fall mit einem Verdächtigen aus der besseren Gesellschaft zu tun. Dieser war gut alimentiert und schien finanziell nicht in Nöten zu sein. Der Untersuchungsrichter merkte, dass sein Verdächtiger ziemlich herablassend und arrogant war. Froget ließ sich davon nicht beeindrucken, er wirkte sogar gleichgültig. Schließlich ging es um die Aufklärung eines Mordes und da sollte der gesellschaftliche Status keine Rolle spielen. Der besondere Aspekte sollte eine Rolle spielen.
Weiterlesen
Arsen
Immer wieder stellt sich die quälende Frage: »Wie bringe ich den Kerl um?« Das richtige Gift sollte ein ambitionierter Mörder schon gewählt haben. Liest man klassische Kriminalromane, wird der Anfänger geradezu mit der Nase in Arsen gestupst. Es könnte auf die Idee kommen, es wäre eine Empfehlung. Hier ist einmal notiert, warum dieses Element keine gute Idee ist.
Weiterlesen
Ein Seher?
Der Mord selbst blieb ungesühnt. Über Jahre wurde spekuliert, wer den bekannten Schauspieler und Regisseur William Desmond Taylor umgebracht haben könnte. Es gab einige Verdächtige, aber keinem konnte der Mord nachgewiesen werden. Ein Rätsel, mag mancher meinen. Aber ein Geheimnis war lange Zeit nicht nur der Tod des Mannes ...
Weiterlesen
Eine halbe Stunde
Heute ist es natürlich ganz anders: Wird ein Arzt zu einem Verstorbenen gerufen und von einem Ermittler gefragt, was denn die Todesursache ist, dann äußert dieser sich ganz vorsichtig. Zumindest ist das im Fernsehen so. Die Kollegen in den etwa älteren Büchern agieren offener und geben recht schnell preis, was sie für die Todesursache halten. So auch der Doktor, der zu Kapitän Joris gerufen wurde.
Weiterlesen
Wie starb Hélène Lange?
Mein Problem kann eines sein, dass sich auf die deutsche Übersetzung von »Maigret in Kur« beschränkt. Das mag durchaus sein. Ich kann es nicht prüfen, da ich den Titel in französischer Sprache nicht vorliegen habe. Wenn das Problem im Original nicht auftaucht, denn werden die Neuübersetzungen hier vielleicht Abhilfe schaffen. Sollte das so schon im Original stehen, so wäre es eine Schlampigkeit von Simenon.
Weiterlesen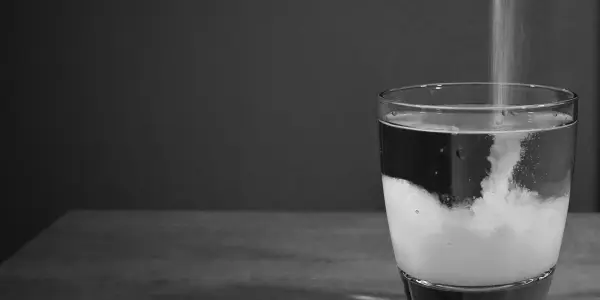
Marie Dudons Umschlagtuch
Einmal mehr wird der literarische Beweis geführt, dass sich Verbrechen nicht lohnen. Madame Dudon beobachtet, wie Madame Cassieux ihren Gatten umbringt. Zielstrebig versucht Marie Dudon einen eigenen Vorteil daraus erzielen.
Weiterlesen
Das Verbrechen des Unliebenswürdigen
Eine hohe Miete für ein Objekt mag sich auf den ersten Blick als Glücksfall erweisen. Aspekte, die ein solches Glück torpedieren können, gibt es allerdings viele: Eine Leiche in einem Wandschrank kann auch einen Vermieter zu einem Problem werden.
Weiterlesen
Die goldene Tabatiere
Es gab Akten, die wollte Leborgne nicht zeigen, weil sie langweilige waren. Aber diese Akte, das bemerken Erzähler und Leser sofort, wollte er aus anderen Gründen nicht herzeigen. Warum nur?
Weiterlesen
Die Bombe im Astoria
In einem Bahnhofshotel in Brüssel geht eine Bombe hoch. Opfer ist ein gewisser Goldstein, der aus Berlin gekommen war.
Weiterlesen