
Bildnachweis: –
»Le 36, Quai des Orfèvres«
Für Gelegenheitsleser von Maigret-Geschichten ist es uninteressant. Wer jedoch alles in dieser Hinsicht von Simenon verschlungen hat und sich zudem für Geschichte interessiert, der fragt sich: Was war eigentlich bei der Kriminalpolizei von Paris so los? Mit der Nase auf diesen Sachverhalt gestupst, wird man bei den verschiedensten Gelegenheiten.
Die Lücke mag Simenon nicht schließen. Lässt er den Pariser Kommissar anfangs noch durch ganz Frankreich tingeln, was gut für das Verlagsgeschäft und dadurch mögliche Sammelbände wie »Maigret in der Provence« und »Maigret in der Normandie« ist, jedoch wenig mit der Realität zu tun hat. Denn der Zauber der Polizei-Organisation in Paris liegt gerade darin, dass sich die Pariser Polizisten auf Paris zu konzentrieren haben. Simenon wurde schon frühzeitig auf diesen Lapsus hingewiesen. Korrigieren tat er ihn erst in späteren Werken, in welchem das fokussierte örtliche Wirken der Pariser Polizei thematisiert wurde.
Aber es gibt auch andere Lücken: Immer wieder ist davon die Rede, dass die Polizei reformiert wurde. Warum und weshalb, das erklärt uns Simenon in den Büchern nicht. Jüngere Leute kommen in Führungspositionen, nachdem die alten gegangen sind, und die wollen alles ändern. Das gefällt Maigret nicht, aber dagegen angehen lohnte nicht. Zumal er allzu oft in den Stories direkt vor der Pensionierung stand. Und somit »Was soll’s?« sagen konnte.
Viel interessanter ist in diesem Zusammenhang, dass Simenon in allen Maigrets die Zeit der deutschen Besatzung ausspart. Diese findet, obwohl Geschichte in der Zeit entstanden und danach ja noch umso mehr, einfach nicht statt. Diese Fragezeichen müssen Interessierte sich anderweitig beantworten lassen
Eine Möglichkeit, diese Lücke zu schließen, findet sich in dem Buch »Le 36, Quai des Orfèvres« von Clovis Bienveu. (Es gibt eine ganze Reihe von Titeln, die sich mit der Geschichte befassen. Dass es nun dieses ist, was ich wählte, ist reiner Zufall und besagt nichts über die Qualität der anderen.)
Die Geschichte der Pariser Kriminalpolizei

Hin und wieder habe ich an der Stelle schon über die französische und insbesondere über die Pariser Polizei geschrieben, gerade im Hinblick auf die Geschichte. Einen solch umfassenden Blick, wie es ein spezieller Titel liefern kann, ist dabei sicher nicht entstanden.
Bienvenu geht in seinem Buch ganz an die Anfänge zurück und erklärt, wie sich die Institution entwickelt hatte. In seinen Schilderungen werden die Irrungen und Wirrungen, die politischen Machtspielchen und die Kämpfe der verschiedenen Polizeien beschrieben.
Ein Augenmerk wird dabei – und bis dahin bin ich beim Lesen des Buches nun schon gekommen – auf die Ära der deutschen Besatzung geworfen. Also gerade die Zeit, die ein dunkler Fleck zu sein scheint. Wie man sich denken kann, hatten die deutschen Besatzer sehr schnell dafür gesorgt, dass sich die Kriminalpolizei in ihrem Sinne diente. Klar, dass dabei Personal ausgetauscht wurde. Auch wurde die Behörde umorganisiert und bekam Abteilungen, die sich auf sehr spezifische Nazi-Belange konzentrierte. Das wären alles interessante Aspekte für unseren Kommissar gewesen, der die Zeit aber in einer Art Winterschlaf zu überdauern schien.
Verstehen kann man, dass Simenon während der Besatzungszeit das Thema nicht thematisierte. Ein wenig ratlos lässt einen zurück, dass er dies nicht in der Nachkriegszeit aufgegriffen hat und sei es nur am Rande. Stattdessen klafft nun eine Lücke und geschichtliche interessierte Leser wie ich, fragen sich, wie der Kommissar die Zeit überstanden hat.
Nach der Lektüre der entsprechenden Kapitel ist klar, dass es keine feine Zeit war. In Bienvenus wird kein Versuch der Schönfärberei unternommen. Spannend wird es gewiss später noch, denn auch in der Algerien-Krisen-Zeit, in der Maigret auch noch im Einsatz war, gab es nach meiner Erinnerung Vorfälle in der Pariser Polizei, die nicht zu deren Ehre gereichten.
Man erfährt aber auch ganz witzige Tatsachen in dem Buch. Beispielsweise durften ermittelnde Polizisten lange Zeit, nicht groß sein. Als Begründung wurde angegeben, dass die Größe sie bei Beschattungen verraten könne – und das wolle man ja vermeiden. Außerdem gab es – wie Simenon es auch einigen Inspektoren immer als Marotte zuschrieb – einen Hang, sich für Observierungen zu verkleiden.
Und Maigret?
Schon auf den ersten Seiten wird auf Simenon und den Kommissar Bezug genommen. In den weiteren Kapiteln tauchen dann Namen auf, die Simenon in Erinnerungen erwähnte und die in »Maigrets Memoiren« Einzug fanden.
In dem Buch heißt es zu der Beziehung beispielsweise:
Vom Quai des Orfèvres her war die Kritik rein sachlicher Natur. Xavier Guichard hob die Ungereimtheiten hervor und scheute sich nicht, dies jenem ehemaligen Gerichtsreporter mitzuteilen, der regelmäßig für die Zeitschrift »Détective« arbeitete. Der Direktor lud ihn umgehend ein, um ihm zu erklären, dass der Beruf eines Kommissars bei der Kriminalpolizei alles andere als einsam war, dass Observierungen und Beschattungen ausschließlich in die Zuständigkeit der Inspektoren fielen und dass Ermittlungen in der Provinz oder im Ausland der Sûreté nationale in
der Rue des Saussaies oblagen.
Simenon hatte selbst zugegeben, dass Maigret so etwas wie der »ältere Bruder« von Kommissar Marcel Guillaume war, aber auch geprägt war von Georges-Victor Massu und einer ganzen Reihe anderer Polizisten, die der Schriftsteller während seiner Recherchen traf.
Aber nicht nur bei Maigret ließ er sich inspirieren. So heißt es:
Einer von Maigrets direkten Mitarbeitern, der junge Janvier, ist nicht mehr und nicht weniger als von Inspektor Février inspiriert – jenem berühmten Polizisten der ersten mobilen Brigade von Versailles, der im März 1928 gemeinsam mit den Männern von Kommissar Guillaume an den Ermittlungen zum Tod von Gaston Truphème arbeitete; ein Fall, der Simenon zweifellos geprägt hat, insbesondere im Hinblick auf die ihm so wichtige Konfrontation zwischen Kommissar und Mörder.
Immerhin hat Simenon den Namen des Inspektors geändert, dass er nur noch für Insider zu erkennen war.
Also auch im Hinblick auf Simenon, dem ein kleineres Kapitel gewidmet ist, finden sich interessante Ausführungen. Nur wegen dieses thematischen Ausflug sich das Buch zu besorgen, wäre übertrieben. Interessant ist es für alle, die sich für die Kriminalpolizei, wie sie wirklich war, interessieren.
Das Buch ist gespickt mit Fußnoten, was den Lesefluss etwas hemmt. Sie zu ignorieren, wäre indes fahrlässig, weil ich dort viele Informationen finde, die zur weiteren Recherche einladen.
Wermutstropfen wie so oft: Eine deutsche Ausgabe dieses Buches gibt es nicht.
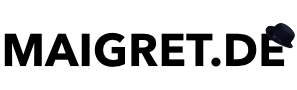

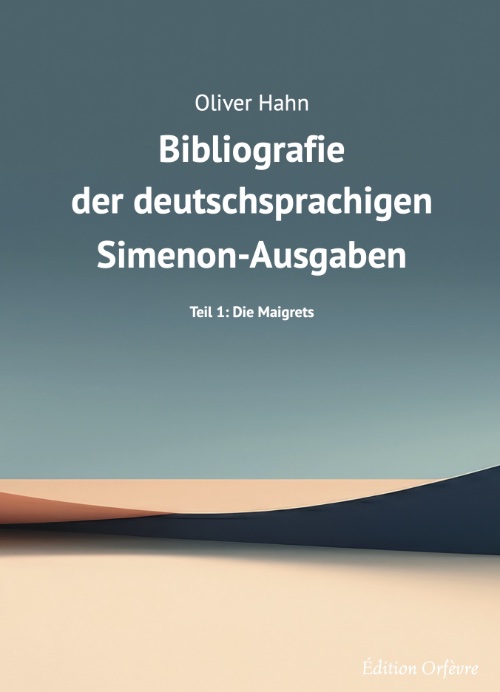 Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.
Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.

