
Bildnachweis: –
Problematisch
Zufall war es, dass ich eine Kurzgeschichte hervorgekramte: »Das Geheimnis des Grandhotels ›Sankt George‹« hatte ich aufgeschlagen, dessen Handlungsfaden mir fremd war. Hätte ich nachschlagen können – ich weiß! –, aber so lang ist die Geschichte nun auch wieder nicht. Die ersten Absätze lesend, ahnte ich, das könnte eine problematische Angelegenheit werden.
Nehmen wir den reinen Spannungsbogen, so war die Geschichte bei weitem nicht so langweilig, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Bei mancher von Simenons Kurzerzählung habe ich mich nach dem Lesen gefragt: »Was wollte mir der Künstler damit sagen?« Ist in diesem Fall, das kann ich versprechen, nicht so.
Diese Geschichte brauchte nur paar Worte – Vilnius, Wodka –, da hatte mich Simenon schon getriggert.
Das schafft er mühelos, wenn er Stories mit solch einem Hintergrund versieht. Seine Reisen in die östlichen Gegenden Mitteleuropas sind bekannt und er hat das Elend, das dort herrschte, sowohl dokumentiert (wie Interessierte später in den Fotoausstellungen sehen konnten) und nutzte die Erinnerungen für Schilderungen des Elends.
Die literarische Schilderung ist glaubwürdig und realistisch. Simenon erkannte auch, dass dies ein Grund der Migration aus der Region nach Frankreich war.
Wahrscheinlich hätte er es noch nicht einmal mit eigenen Augen erblicken müssen – die Pensionsgäste seiner Mutter werden genügend Eindruck hinterlassen, da sie in stattlicher Anzahl aus diesen Landstrichen kamen.
Völlig unabhängig davon, ob die eigentliche Geschichte in Frankreich spielt oder er die Handlung in diese Gegend verlegte, gehe ich innerlich in eine Hab-Acht-Stellung – und werde meistens nicht enttäuscht. Meines Erachtens betrifft das insbesondere die Erzählungen und Romane aus den 1930er-Jahren. Später hat Simenon sich an die politischen Gegebenheiten anpassend, die Story-Elemente nicht mehr aufgenommen. Wer kann sich noch an einen Polen in den Geschichten nach 1950 erinnern?
Der Kutscher und sein Passagier
Der Held der Geschichte ist … Schultz. Ein versoffener Kutscher, der mit Ted Moran den Kundenfang seines Lebens machte. Moran ließ sich von Schultz zu verschiedenen Orten bringen und dieser bemerkte, dass sein Kunde sehr ekelhaft zu anderen Menschen war.
Was ihm auch auffiel, dass er zwar polnisch sprach – aber er betonte, dass lokale Dialekt wäre und Schultz meinte herauszuhören, dass er aus dem Ghetto käme.
Da die Bezahlung gut war, störte ihn das nicht und er verkraftete die Ruppigkeiten. Vielleicht waren reiche Amerikaner aus San Francisco so, woher sollte er das wissen? Er wusste nur, dass er mit diesem Fabrikanten einen dicken Fisch an der Leine hatte, der ihm seinen Wodka finanzierte.
In dem Hotel, in dem Moran abgestiegen war, beobachtete man den merkwürdigen Gast. Der hatte sich ein zweites Zimmer genommen und quartierte doch einen weiteren Mann ein. Zuvorkommend behandelte er ihn nicht, das Hotelpersonal vermutete, dass er ihn hungern ließ. Auch von Schreien war die Rede. Wie wenig gastfreundlich der amerikanische Firmenbesitzer war, ließ sich auch daran erkennen, dass sich sein. Besuch erhängte und die Scherereien wurden von Moran auf der Personal abgewälzt.
Wir haben es mit einer Person zu tun, die gleichzeitig mysteriös und unsympathisch ist. So viel zu den Grundgegebenheiten.
Goldfinger und das Geld
Die Stimmung kippt, als Moran die Katze aus dem Sack lässt und enthüllt, dass er eigentlich »Goldfinger« hieße. Das ist noch nicht die Stelle, an dem Alarmglocken schrillen sollten. Denn der Name ist durchaus ein realer, historisch gewachsener jüdischer Familienname. Die Problematik entsteht durch den Rest …
Denn ist man durch den Namen erst einmal in die Richtung gestupost worden, werden andere Aspekte viel klarer. Beispielsweise die Einführung, dass man den Akzent des Ghettos hören würde.
Als Ghettos wurden damals vorwiegend jüdische Viertel angesehen (heute wird der Begriff weiter gefasst). Je nachdem, welchen Zeitpunkt der Geschichte betrachtet wird, handelt es sich entweder um Orte, wo Juden untereinander lebten oder dort leben mussten. Den Zwang, dort zu residieren, gab es für die Juden nur in bestimmten Perioden. Dass wir heute Juden-Ghettos mit einer Internierung gleichsetzen, ist mit dem Handeln der Nazis verbunden. Für diese waren diese zentrale Elemente der nationalsozialistischen Judenverfolgung und wurden speziell für diesen Zweck geschaffen.
Betrachtet man Ghettos jenseits der Nazizeit, so gilt es auch als Klischee, diese mit Armut zu verbinden.
... sein Mund zu schmal, während seine Nase eine jüdische Herkunft verriet.
Und an der Stelle haben wir ein typisch antisemitisches Klischee. Es gibt keinerlei Indizien dafür, dass man Juden an ihren Nasen erkennen könnte. Außer vielleicht in Zeichnungen von Juden, die von anderen Bevölkerungsgruppen gezeichnet wurden, um sie als Juden zu charakterisieren. Wie schon bei der Ghetto-Thematik konnte man die richtigen schlimmen Auswüchse dieses Antisemitismus während der Nazizeit beobachten. Simenon hat es von denen nicht übernommen, da es historisch gewachsen war.
Zwischenzeitlich kam die Familie durch eine Erbschaft zu Geld. Was war das für Geld? Von einem Wucherer? Das mochte auch ein Grund gewesen sein, warum sich die Einheimischen gegen die Familie verschworen, sie beraubten und die Frauen umbrachten. Auch hier hat man ein klassisches Vorurteil, dass Juden immer mit Geld zu tun haben. Für Simenon wäre es ein leichtes gewesen, den verstorbenen Juden als erfolgreichen Handwerker in die Geschichte zu integrieren. Stattdessen …
Problematisch ist auch, dass die Brutalität und die immer wieder erwähnte Kälte (»der Blick«), die Moran/Goldfinger zugeschrieben wird. Diese Aspekte könnten Vorurteile über die typische jüdischen »Rachsucht« bedienen.
Manchmal hilft ein Blick in die klassische Literatur. In dieser lassen sich deutliche Unterschiede zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Rachefiguren beobachten. Nehmen wir Shakespeares Shylock aus »Der Kaufmann von Venedig«: Er gilt als Prototyp eines jüdischen Rachecharakters. Seine Rache war von Systematik und Legalismus geprägt. Er berief sich zwar auf Prinzipien wie Gerechtigkeit und Gleichbehandlung, verfolgte seine Ziele jedoch mit Kälte und Berechnung. Typische stereotype Merkmale waren seine langfristige Planung, die Geduld, der Einsatz materieller Mittel sowie die emotionale Distanz, die bei ihm bei der Ausführung der Rache zu sehen war.
Auf der anderen Seite stehen nicht-jüdische Rachefiguren, wie etwa Edmond Dantès aus Dumas’ »Graf von Monte Cristo«. Seine Rache war geprägt von Leidenschaft und Emotionalität. Dantès nutzte aristokratische Mittel und inszenierte seine Vergeltung theatralisch.
Auch Hamlet trug seine Rache emotional aus: Seine Handlungen waren von Zögern, moralischen Skrupeln, Melancholie und Selbstzweifeln begleitet – die Rache hat hier eine tragische Dimension.
Simenons Figur Goldfinger weist in manchen Aspekten Parallelen zu jüdischen Rachestereotypen auf: Auch bei ihm steht eine methodische und brutale Vorgehensweise im Vordergrund. Er nutzte seinen Reichtum als Machtinstrument und ging systematisch gegen die von ihm ermittelten Täter vor. Er schreckte vor Folter nicht zurück und zeigte dabei eine erschreckende emotionale Distanz.
Gleichzeitig unterscheidet sich Goldfinger von den genannten Stereotypen: Seine Rache beinhaltet körperliche Gewalt und spontane Brutalität. Er stand bei der Racheaktion im Mittelpunkt und agierte nicht über Mittelsmänner – die Körperlichkeit und Unmittelbarkeit stehen im Gegensatz zur abstrakten, distanzierten Planung klassischer Stereotypen.
Ja, aber ...
Die Frage, ob antisemitische Klischees zu finden sind, kann eindeutig bejaht werden. Wie schon in der Vergangenheit bei ähnlichen Gelegenheiten geschrieben, ist der Text von Simenon ein Kind seiner Zeit. Simenon hinterfragt sie nicht, sondern übernimmt sie und sie mögen Teil seiner Erziehung gewesen sein.
Während die Motivation nachvollziehbar geschildert wird (das ist das Licht in der Story, wenn man erst einmal dem Antisemitismus auf die Schliche gekommen ist), reproduziert sie gleichzeitig gefährliche antisemitische Klischees, die zur Stigmatisierung beitragen können, wenn auf diesen Aspekt nicht hingewiesen wird.
Ich komme an der Stelle nicht mit dem großen Cancel Culture-Hammer. Da die Motivation von Simenon, die Gewalt gegen Juden aufzuzeigen, positiv zu bewerten ist, wäre es zu begrüßen, wenn bei einer Wiederveröffentlichung, von der weit und breit nichts zu sehen ist, ein Vorwort diese Probleme und Widersprüche einordnet.
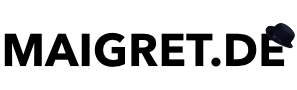

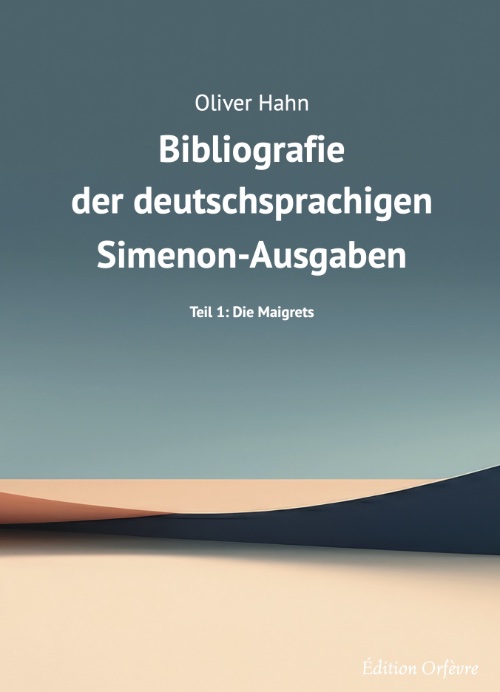 Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.
Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.

