
Bildnachweis: Irgendwie komisch - maigret.de
Kapitel 6, Abschnitt 3
Wie könnte ich einen Illustrator, einen Dichter und eine Drucktechnik unter einen Hut bringen? Vor allem dann, wenn es auf dem ersten Blick keine Beziehung zwischen den beiden Personen gibt; und der Dichter mit der Drucktechnik auch nicht viel am Hut gehabt haben dürfte. Das Verbindende ist das sechste Kapitel und in diesem der dritte Abschnitt des Gehängten-Romans.
Maigret kam in die Rue Haute-Sauvenière in Lüttich. In der Straße lebte Jef Lombard und dem wollte er einige Fragen stellen. Wie es der Kommissar gewohnt sein durfte, war Joseph van Damme schon vor Ort.
Auch ohne die beiden Herren wäre die Situation für Lombard sehr aufreibend gewesen – er wurde gerade das dritte Mal Vater. Mit den beiden wurde es »krass anstrengend«. Gut, dass der Handwerker von seiner Schwiegermutter aus dem Raum geholt wurde, um die Neugeborene zu begrüßen. Ein Mädchen war es!
Wie sein Freund machte van Damme einen nervösen Eindruck. Maigret indes schaute sich in aller Seelenruhe um.
Ein Vorreiter?
Maigrets Interesse weckte aber vor allem eine Reihe von Zeichnungen ganz anderer Art, lauter Variationen desselben Themas nämlich. [...] Sie waren ganz anders beschaffen, romantischer, als hätte ein Anfänger Gustave Doré nachgeahmt.
Der Kontext hilft oft. Simenon musste nicht schreiben, dass es sich bei Doré um einen Illustrator und Maler handelte. Die Leserinnen und Leser erkennen den Zusammenhang automatisch und können deshalb, auch wenn sie den Künstler nicht kennen und sie keine Neugierde befällt, einfach darüber hinweggehen. Für den Fortgang der Geschichte ist es nicht notwendig, sich damit zu beschäftigen, wer dieser Gustave Doré war.
Für meine psychische Gesundheit schon. Zu oft habe ich feststellen dürfen, dass sich hinter denen von Simenon verwendeten Namen, die wie ein Adjektiv wirken, sich die erstaunlichsten Leben und Geschichten verbergen.
Gustave Doré also.

Lieber will ich mein zweites Gefühl benennen, dass mich beim Lesen seiner Biografie und beim Betrachten seiner Bilder überkam: Respekt. Die erste Empfindung war eine andere. Nobel lässt sie sich bei Gott nicht nennen. Wenn ich jedoch lese, dass ein Fünfjähriger Briefe verfasst (okay, das habe ich vielleicht auch, aber über das Niveau müssen wir gar nicht anfangen zu diskutieren), und dann eine Illustration aus einem dieser Briefe sehe, tja, dann reden wir von Neid. Denn würde ich in meinem gereiften Alter zu einem Stift greifen, würde gewiss nicht das herauskommen, was der Bube damals fabriziert hat.
Die Zeichnung entstand 1837. Doré lebte in einem wohlhabenden Haushalt und musste sich keine Sorgen machen. Der Vater war Ingenieur und in einer guten Position. Die Familie lebte in Straßburg. Ganz typisch für einen Papa der damaligen Zeit (und heute wohl auch noch oft genug) war, dass er der Meinung war, dass sein Sohn in seine Fußstapfen treten sollte. Er wird erkannt haben, was für ein Talent sein Sohn hatte. Eine Karriere in Künstlerkreisen mochte er sich für seinen Gustave nicht vorstellen. Das war für ihn der Weg ins Prekariat.
Seine Mutter sah das anders: Sie förderte den Sohn, wo es nur ging und unterstützte ihn auf seinem Weg als Künstler.
Er hatte zwei Brüder: Der zwei Jahre ältere Épinal Doré hatte Ambitionen, Komponist zu werden. Eine kurze Recherche erzeugt den Eindruck, dass ihm kein Erfolg beschieden war und er sein Leben als Bankangestellter bestritt. Sein zwei Jahre jüngerer Bruder Émile Paul wurde später General. Und obwohl in einem Nachruf stand, dass er »nach seinem Tod die Erinnerung an einen der brillantesten Offiziere unserer Waffengattung hinterlassen [wird].«, ist er heute nur noch eine Fußnote.
Eine Karriere als Ingenieur schlug keiner der Jungs ein.
Als Achtjähriger organisierte er einen Umzug zum vierhundertsten Geburtstag von Gutenberg – die Idee hatte er, da eine Statue in der Stadt eingeweiht werden sollte. Die Figur gibt es heute übrigens noch und kann auf dem – Überraschung! – Place Gutenberg besucht werden.
Im Jahr 1841 bekam der Vater einen neuen Posten in Bourg-en-Bresse und die Familie zog um. Seine erste Veröffentlichung hat er mit dreizehn Jahren. Bei einem Besuch in Paris traf sich Doré mit dem Verlagsdirektor Philipon von Aubert & Cie, der die Zeitschrift »Le Charivari« gegründet hatte. Beeindruckt von den Zeichnungen des Jungen, bot Charles Philipon diesem einen Drei-Jahres-Vertrag an. In einer neuen Wochenzeitung sollte er mit jeder Ausgabe die eigene Seite erhalten. Eine großartige Gelegenheit für den jungen Künstler, allerdings musste erst der Vater überzeugt werden, der den Vertrag zu unterzeichnen hatte.
Im selben Jahr lässt sich Doré in Paris nieder, wo er das Lycée Charlemagne besucht. Seinen Vater sollte er nicht mehr sehen, der starb zwei Jahre später im Alter von 47 Jahren. Daraufhin zog seine Mutter nach Paris und bewohnte mit ihren drei Söhnen ein Herrenhaus.
In den folgenden Jahren machte sich der Künstler einen guten Namen. Seine Gemälde und Zeichnungen wurden im Salon im Haus seiner Mutter ausgestellt. Er wurde an den Hof eingeladen, die ersten Werke wurden vom Staat erworben. Einen Großteil seiner Arbeit machten Illustrationen für Bücher aus – bis zu seinem Tod sollte er über hundertzwanzig Ausgaben illustrieren.
Ein Meilenstein sollte seine grafische Erzählung »L'Histoire pittoresque, dramatique et caricaturale de la sainte Russie« sein, in der er sich mit dem Krim-Krieg von 1853/54 auseinandersetzte. Es war das erste Mal, dass er sich in einem Werk politisch äußerte und unzweifelhaft ist auch, auf welcher Seite er stand – es wird als Anklage gegen Russland verstanden. (Kleine Nebenbemerkung: Liest man sich durch, was die Motivation Russlands damals gewesen ist, meint man eine Blaupause für die Argumentation von Putin zu erkennen. Böse Zungen könnten ihnen einen Plagiator nennen.) Ein anderer Aspekt dieses Werkes ist, dass Dorés Schöpfung als Vorläufer des Comics, wie wir ihn heute kennen, verstanden werden. Kenner loben sein Spiel mit Text und Illustration und waren und sind beeindruckt von den grafischen Tricks, die Doré anwendete.
In der Folge kümmerte er sich um Zeichnungen für Dantes »Göttliche Komödie«. Der Künstler hatte Vorstellungen von dem Buch, das er veröffentlichen wollte. Verleger, mit denen er sprach, mochten da nicht mitgehen – es war ihnen zu luxuriös aufgemacht und sie sahen nicht den entsprechenden Markt. Sie sollten sich täuschen, denn Doré produziert das Werk auf eigene Kosten und es wurde nicht nur ein Erfolg bei den Kritikern, sondern auch kommerziell.

Nach der »Göttlichen Komödie« widmete er sich der Bibel, die 1866 in zwei Bänden veröffentlich wurde. Nun wurde er auch in England populär. In London eröffnete er eine Galerie unter seinem Namen. Für diese produzierte er eine ganze Reihe von Gemälden mit religiösen Themen, die bis in die Vereinigten Staaten verkauft wurden. Während des Krieges mit Deutschland verlegte er sich auf patriotische Gemälde und wirkte auch aktiv mit, Paris vor der preußischen Armee zu beschützen.
Im Jahr 1872 publizierte er eine grafische Reportage über London – »London: A Pilgrimage«. Das Werk kam nicht bei allen Betrachtern gleichermaßen gut an. Für den Geschmack mancher hatte er sich zu sehr auf die ärmeren Viertel der englischen Hauptstadt konzentriert. Unter künstlerischen Aspekten gilt der Band als einer seiner Höhepunkte.
Doré sollte nur vier Jahre älter werden als sein Vater. Am 23. Januar 1883 starb er an einem Herzinfarkt im Alter von 51.
Wer heute seine Werke betrachten möchte, der sollte das »Musée de Brou« in Bourg-en-Bresse aufsuchen. Die »Bibliothèque des musées« in Straßburg und auch das »Musée d'Orsay« in Paris besitzen eine staatliche Anzahl von Werken des Künstlers.
Ein Vorbild?
Wer zählt eigentlich zur »französischen Literatur«? Wer in Frankreich geboren wurde, in der Sprache schrieb und oder innerhalb der Grenzen das Landes starb – der hat einen Platz auf einer Liste offenbar Literatur sicher. Vorausgesetzt sie oder er schrieben in einer Qualität, die gewürdigt werden kann.
Wer französischsprachig mit seinen Werken unterwegs war und in Frankreich geboren oder gestorben war, hat offenbar auch eine Chance, aufgenommen zu werden. Aber wie sieht es mit denen aus, die in französischer Sprache schrieben, im Sprachmutterland lebten – aber weder dort geboren noch gestorben waren? Da ist die Aufnahme nicht mehr sicher.
So interpretiere ich das Kompendium »Namen, Titel und Daten der französischen Literatur« vom verstorbenen Professor Gert Pinkernell, in der Simenon nicht auftaucht. Pinkernell hat sich zu seinen Lebzeiten einen Namen als Romanist gemacht und nach seiner Emeritierung viele Beiträge über französische Literatur in der Wikipedia veröffentlicht und bearbeitet (was ihn sehr sympathisch macht – darüber hinaus publizierte er im Ruhestand scherzhafte Tiergedichte).
Auf die Pinkernellsche Liste bin ich aber aus einem ganz anderen Grund gestolpert:
Über einer anderen Skizze standen ein paar Zeilen: vier Verse aus Villons »Ballade der Gehenkten«.
Gleiches Prinzip wie bei Doré: Verse von Villon – wird wohl ein Dichter gewesen sein. Die Frage, was für einer, galt es jedoch zu klären. In Frankreich, hieß es an einer Stelle, würden diverse Schulen den Namen François Villon tragen, aber es gäbe auch Diskussionen, ob es verdient wäre. Das lässt aufhorchen.
Nun immerhin ist ein 1431 geborener Mann nicht in irgendwelche Schandtaten der letzten hundert Jahre verwickelt – also keine Verbrechen im Ersten oder Zweiten Weltkrieg, war auch nicht an irgendwelchen kolonialen Auseinandersetzungen bezeichnet wie in Nordafrika oder Vietnam. In den Schulgremien kann also durchgeatmet werden. Aber nur kurz.
Ich will es so zusammenfassen: Villon hatte eine sehr persönliche Beziehung zum gehängt werden.
Der Mann wurde als François de Montcorbier geboren, irgendwann in dem zuvor genannten Jahr, vielleicht in Paris. Sein Vater starb offenbar früh und er kam in die Obhut von Guillaume de Villon, dessen Name er später annahm.
Von ihm ist bekannt, dass er die Universität besuchte und dort die schönen Künste studierte. Sorglosigkeit prägte sein Leben im Quartier Latin – er war halt ein Student, wie er im Buche steht (also in früheren Büchern zumindest).
Der erste Bruch mag die Tötung eines Priesters gewesen sein. Zu der Zeit hatte er nicht mehr den Status eines fröhlichen Studenten, der war vermutlich Mitglied einer Bande von Gaunern. Der Priester bat auf dem Sterbebett darum, dass auf eine Bestrafung verzichtet wird – solch ein Wort hatte damals noch Gewicht. Villon verließ die Stadt vorsichtshalber trotzdem, und offenbar wurde die Angelegenheit auch untersucht. Begnadigungsurkunden des Königs Charles VII. besagen, dass es sich um einen Fall von Notwehr handeln und es ermöglichen es dem jungen Mann, nach Paris zurückzukehren.
Das erste Werk, welches François Villon zugeschrieben wird, ist die »Ballade des Contre-Vérités«. Ein Zeitgenosse von ihm, Alain Chartier, hatte eine Lobpreisung der Tugend geschrieben. Dieser wurde von dem Jung-Dichter zu Ratschlägen für Gauner umgedichtet. Seine Zielgruppe war das »akademische Proletariat«, eine Wortschöpfung, die ich ziemlich interessant finde. Seinen »Markt« musste Villon nicht lang suchen, er war Teil des selbigen.
Dieses Werk wird auf das Jahr 1456 datiert und in diesem Jahr viel es ihm mit vier Kollegen ein, den Tresor des Collège de Navarre auszuräumen. Wie schon bei der Priester-Geschichte machte sich Villon nach dem Diebstahl aus dem Staub, hinterließ seinen gebildeten Gauner-Freunden aber das »Lais«, was als sein erstes größeres Werk angesehen wird. Das in Ich-Form geschriebene Pamphlet gibt auch Auskunft darüber, was er für Pläne hatte – die waren in dem Fall, dass er nach Anger gehen würde. In dem Protokoll einer Vernehmung eines Komplizen wurde dies ebenfalls erwähnt.
Im Jahr darauf saß der Dichter in Blois ein und wartete auf seine Hinrichtung. Die Gründe für die Verurteilung sind nicht bekannt, aber Villon hatte wiederum Glück: Nur die rechtzeitige Niederkunft der Gattin von Charles d'Orléans – der für das Gebiet zuständige Herzog – und die Tatsache, dass sie gesund eine Tochter gebar, retteten ihn vor der Exekution. Er bedankte sich mit einer Ballade.
Überhaupt war man zu der Zeit geneigt, entweder zu den Waffen zu greifen und sich zu duellieren. Oder es wurden Gedichte geschrieben. Villon konnte, an den Hof des Herzogs eingeladen, es nicht unterlassen, ein wenig Spott über einen Mann zu verbreiten, der von dem Herzog protegiert wurde. Daraufhin wurde er in zwei Gedichten getadelt und vor die Tür gesetzt.
Er versuchte bei späterer Gelegenheit an anderem Orte sich wieder in die Gunst des Herzogs zu dichten. Zumindest mit der zweiten Ballade konnte er ein Geldgeschenk erzielen.
Was für merkwürdige Zeiten, nicht wahr?
Im Sommer 1461 saß er im Kerker des Bischofs von Orléans ein. Die Gründe, warum er dieses wenig bequeme Quartier beziehen musste, und wie lange er in diesem untergebracht war, sind nicht bekannt. Villon gab sie auch in lyrischer Form nicht preis. Was jedoch bekannt ist – und hier schlägt ob der Nennung vielleicht das Herz von Maigret-Liebhaber:innen höher –, ist der Ort: Meung-sur-Loire.
Gut, dass es damals noch keine Computer gab: Hätte der neue König Louis XI. das Vorstrafenregister von François Villon durchgeschaut, hätte er vielleicht auf eine Begnadigung verzichtet. Aber er hatte den Herzog von Orleans im Gefolge und es ist vorstellbar, dass dieser ihm bei der Gelegenheit vorgeschwärmt hatte, was für schöne Balladen der Mann im Kerker des Bischofs fabrizierte.
Nach seiner Freilassung kehrte er in die Region von Paris zurück. Dort fing er an, das »Testament« zu verfassen, eine Sammlung von Balladen. Teilweise hatte er sie schon zuvor verfasst, teilweise waren sie neu. Dieses Werk gilt als sein Hauptwerk.
Hier gibt es eine fast lyrische Reihenfolge: Auf eine dichterische Arbeit folgt ein Verbrechen oder zumindest ein Vergehen. 1462 wurde er verhaftet, weil er einen Diebstahl begangen hat. Kurz vor seiner Freilassung erfuhren aber von seinem Einbruch im Collège de Navarre Betroffene von dem noch Einsitzenden und sprachen vor. Villon wurde freigelassen, bekam als Bewährungsauflage aufgebrummt, 120 Taler aus der Gesamtbeute den Bestohlenen zurückzuerstatten.
Im gleichen Monat geriet er in eine Schlägerei, aus der er sich heraushielt. Da einem der Ruf aber irgendwann vorauseilt, wurde Villon am nächsten Tag festgenommen und in einem Prozess zum Tode verurteilt. In der Zelle sitzend fielen ihm folgende Verse ein, die ihn bekannt machen sollten:
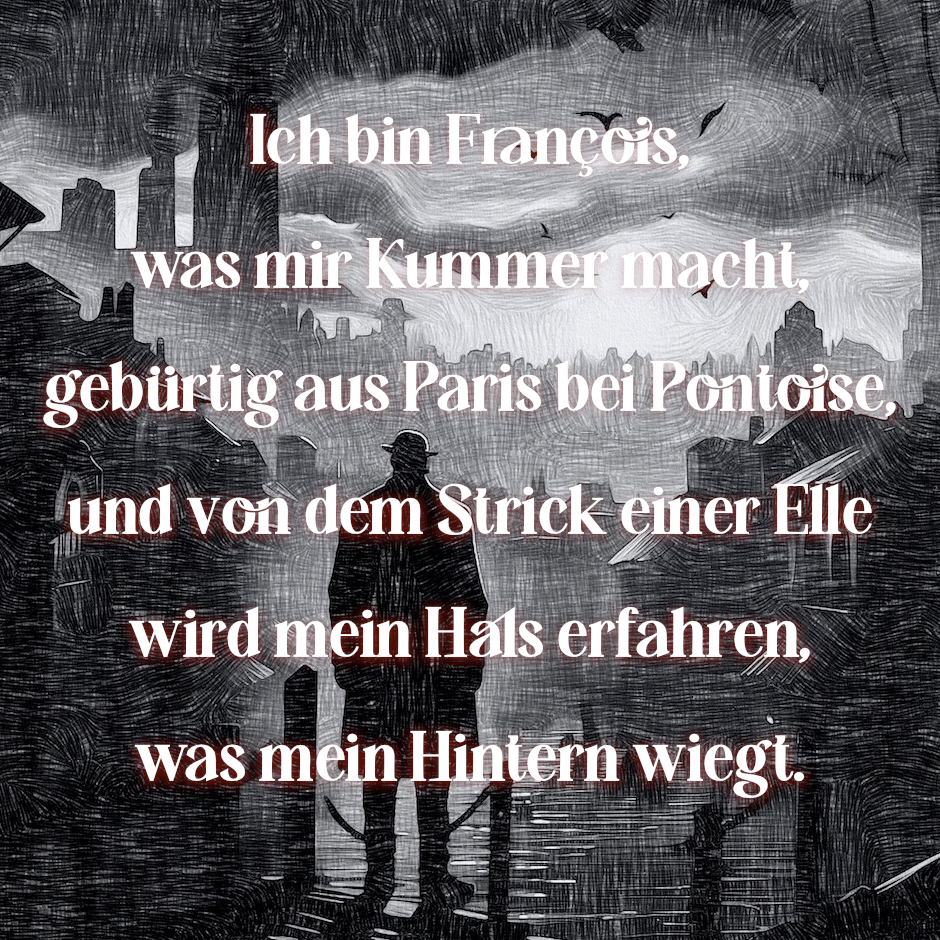
In dieser Zeit entstand vermutlich auch die »Ballade des pendus« (dt.: »Ballade der Gehenkten«). Zumindest ist das die Annahme, die Gert Pinkernell vertrat, und er verwies auf den verzweifelten und makabren Ton. Ein anderer Literatur-Wissenschaftler, Claude Thiry, mag diese Möglichkeit nicht ausschließen, sieht es jedoch nicht als erwiesen an. Die Angst vor dem Hängen, die in diesem Stück zu spüren ist, findet sich auch in früheren Texten – und in der Zeit war Villon nicht inhaftiert gewesen. (Andererseits: Es ist von einem Zeitraum von sieben Jahren und gefühlt war der Mann mehr inhaftiert als in Freiheit. Bei dem von ihm geführten Leben am Galgen zu landen, war so unwahrscheinlich nicht.)
Dass Maigret die Zeilen erkannte, lässt sich zum einen mit seiner guten Schulbildung, die der Kriminalist genossen hatte, erklären. Ein Dichter, nach dem Schulen im ganzen Land benannt wurden, war gewiss zu den (fiktiven) Lebzeiten Maigrets Unterrichtsstoff gewesen. Eine andere, weniger auf Bildung abzielende, und damit auch weniger charmante Erklärung wäre, dass Jef Lombard nicht nur die Verse auf seinen Bilder angebracht hat, sondern die Quelle der Zeilen angegeben hatte.
Der Vierzeiler zuvor gehörte übrigens nicht zu der Ballade. Dieser ist jedoch derart prägnant und leicht wiederzuerkennen, so man ihn erst einmal gehört hat … und irgendwie witzig.
Die gute Nachricht für Villon war, dass er begnadigt wurde. Das Glück blieb ihm holt. Er wurde freigelassen und verschwand aus Paris. Und nicht nur das: Der Schriftsteller verschwand komplett von der Bildfläche. Niemand hörte wieder eine neue Ballade von ihm oder wusste irgendwas über ihn zu berichten. Die gängige Theorie ist, dass er kurz nach seiner Entlassung 1463 verstorben ist. Für viele ist es nicht vorstellbar, dass jemand wie Villon mit dem Dichten einfach aufhören würde.
So bleibt, dass François Villon als Wegbereiter der Lyrik in Frankreich gilt. Gleichzeitig war er im besten Fall ein Rüpel, wahrscheinlich aber auch ein Totschläger oder gar ein Mörder. Die Frage, warum man Schulen nach solch einem Mann benennt, scheint mehr als berechtigt.
Als Vorbild für Dichter mag er taugen, als Mensch eher nicht.
Ein Vorurteil?
Zugegeben, der Sprung von Doré zu Villon war noch nachvollziehbar. Gut vorstellbar, dass es eine dankenswerte Aufgabe für Doré gewesen wäre, die Balladen des Dichters mit Illustrationen zu versehen.
Der nächste Sprung ist nicht ganz so elegant, wenn ich auch glaube, dass die beschriebene Technik zumindest für Gustave Doré sehr interessant gewesen wäre.
Ein Arbeiter kam herein, um sich nach einem Klischee zu erkundigen, das noch nicht fertig war.
In dem Kapitel sind wir immer noch in der Werkstatt des Fotograveurs. Heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Arbeiter hereinkam, um einen Text abzuholen, der schablonenhaft klingt, ist unwahrscheinlich. Mit dieser Formulierung ist also nicht das Stilmittel, gewollt oder ungewollt, gemeint, sondern wir sind viel näher an seinem wörtlichen Ursprung. Denn dieser bezeichnete im Französischen eine Druckform, von der Abzüge hergestellt werden konnten.
Davon ausgehend, dass der Roman entweder in den 1920er-Jahren oder Anfang der 1930er-Jahre, wird der Werkstoff, mit dem gearbeitet wurde wohl Zink oder Kupfer gewesen sein. Simenon erklärt einem Halbsatz gibt Anhaltspunkte, mit was für Materialien solche Klischees produziert wurden, indem er schreibt:
Aus seinen Augen, seinen Gesten, seinem bleichen, von der Säure ganz fleckigen Teint sprach eine verwirrende Mischung aus Freude, Nervosität und vielleicht auch Angst.
In einer solchen Werkstatt wird mit stark ätzenden Stoffen gearbeitet. Lombard tat also gut daran, das Mädel in den ersten Jahren fern von seinen Arbeitsräumen zu halten. Ein weiterer Aspekt wird uns von dem Autor mit an die Hand gegeben, um den Prozess zu verstehen: Fotograveur.
Das liegt in der Herstellungstechnik begründet. Der Graveur hat die Metallplatten mit einer Schicht versehen, die lichtempfindlich war. Dann hat er das mithilfe eines Negativs das Motiv auf die Platte belichtet. Der Teil, der nicht belichtet wurde, wurde im Anschluss weggeätzt. Damit wurden waren die Teile des Bildes, die drucken sollten, erhöht.
Wollte man mit diesen Klischees größere Druckauflagen erzielen, so wurden diese weiter bearbeitet. Dafür wurde Galvanik genutzt.
Statt Metallplatten werden heute häufig Kunststoffe eingesetzt, aber das Prinzip ist noch im Einsatz.


 Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.
Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.
