
Bildnachweis: Französische Kriminallliteratur - Midjourney AI - Bearbeitung: maigret.de
Der erste Auftritt
Schlägt man eine Regionalzeitung auf oder begibt sich auf die entsprechende Online-Präsenz, hat man oft den Eindruck, die Welt wäre schlechter. Nicht, dass die Informationen in den Überregionalen besser wären, aber die bösen Nachrichten in der Lokalpresse spielen sich oft vor der eigenen Haustür ab. Schlechte Botschaften von damals als Trost heute – ob das funktioniert?
Die Polizei- und Gerichtsreporter dürften bei der Produktion der »Wiener Tag«-Ausgabe für den 28. November 1932 ihre Freude gehabt haben. Da hatte sich eine junge Frau im Alter von 22 Jahren mit Stadtgas umgebracht. Schon mit 14 musste sie arbeiten gehen. Ein paar Wochen vor ihrem Suizid hatte sie einen Mann kennengelernt, der sie verführt hatte. Nachdem ihm das gelungen war, fing er an, sie zu belästigen, ihr nachzustellen und sie zu erpressen. Ihr Tod brachte es auf drei Absätze in der Zeitung – der Tod eines 34-jährigen Handelsangestellten, der sich wegen unglücklicher finanzieller Verhältnisse auf die gleiche Weise umbrachte, wurde in drei Zeilen erwähnt.
Schaut man alte Zeitungen dieser Zeit an, fällt auf, dass die Leuchtgas-Tode in jeder Ausgabe eine feste Rubrik waren. Oft waren es jedoch Unfälle, die zum Tod der Gaskunden führten. Sicher auch ein Grund, warum die Umstellung von diesem Gas auf Erdgas ein Fortschritt darstellte.
Sehr präsent auch im Österreich der damaligen Zeit: Nazis. Sie werden Hakenkreuzler genannt und mochten es nicht, wenn ihre Versammlungen und Aufmärsche von den Behörden verboten wurden. Dann trafen sie sich halt zu Spaziergängen und Zusammenkünften anderer Art. Sie waren auch bei Fußballspielen präsent und vermöbelten schon mal die gegnerische Mannschaft.
Groß vermeldet wurde an diesem Tag, dass eine zerstückelte Frauenleiche in der Donau gefunden wurde. Ein Fall wie für Maigret gemacht. Die Leichenteile wurden an unterschiedlichen Stellen gefunden und die Polizei konnte anhand von Experimenten nachweisen, an welcher Stelle die Extremitäten und Organe in die Donau geworfen wurden (oder vielmehr, wo nicht). Eine Schlagzeile der Größe wurde es wohl auch dadurch, dass die Gerichtsmediziner festgestellt hatten, dass es sich um ein Opfer aus der besseren Gesellschaft handeln würde. Sehr gewiss, dass nicht ein Anfänger diesen Fall übernahm.
Weitergeblättert
Der »Wiener Tag« pflegte eine eigene Frauen-Seite. Neben einem großen Artikel zur effektiven Behebung von Wohnungen und einem Beitrag zu einem neu erschienen Buch »Die gute Wiener Mehlspeise« des berühmten Küchenchefs Hans Ziegenbein (spätere Ausgaben kann man heute noch antiquarisch für etwa dreißig Euro erwerben) und einer Programmankündigung der »Freien Vereinigung zur politischen Schulung der Frauen« zum Thema Außenpolitik, gab es einen Artikel eines französischen Korrespondenten. In Frankreich gäbe es einen Sprach-Kultur-Kampf junger Frauen, die sich wehren, mit Mademoiselle tituliert zu werden, nur weil sie unverheiratet wären. Bei Männern, so ihr Argument, würde auch kein Unterschied gemacht: Selbstverständlich würden sie nach der Schule zu einem vollwertigen Monsieur.
Die Zeitung erinnerte an die Blütezeit der Frauenbewegung (die sie nach dem Krieg sah), und dem damaligen Kampf gegen die Unterscheidung zwischen »Frau« und »Fräulein«.
In Pariser Blättern wird erklärt, dass es im Zweifelsfall immer zu empfehlen sei, eine Frau mit »Madame« anzureden. Wenn man es wagen würde, eine verheiratete Dame mit Mademoiselle anzusprechen, so würde sich diese dadurch beleidigt fühlen. Nun ist es begreiflich, dass junge Mädchen sich geschmeichelt fühlen, wenn man ihnen den Ehrentitel Madame zuerkennt. Aber wenn sie in die höheren Lebensregister eingerückt sind, machen sie auf den Titel erst recht Anspruch, da das »Mademoiselle« beweist, dass sie im Kampf um den Mann als Besiegte auf der Strecke geblieben sind.
Die Argumentation gehört erst einmal verdaut. Immerhin ist die Empfehlung, dass man alle Frauen, die das Alter von 20 Jahren erreicht haben, mit »Madame« anredet. Das ist die nächste Falle …
Die Problematik ist übrigens auch in den Romanen von Simenon anzutreffen – vorwiegend in den Maigrets. Denn der Kommissar tappt immer wieder in die Falle, dass er eine Frau mit »Madame« anredet und sie ihn darauf hinweist, dass sie eine »Mademoiselle« wäre. Das ist der umgekehrte Fall, denn hier bestanden die Frauen darauf, dass kenntlich wäre, dass sie nicht verheiratet wären. Beim nächsten Mal, wo ich auf eine solche Stelle stoße, werde ich darauf achten, ob die Frau den Eindruck einer Besiegten macht.
Französische Kriminalromane
Während der Artikel über die Madames und Mademoiselles nicht namentlich gekennzeichnet war, findet sich ein längerer Beitrag auf der folgenden Seite, der den schmucklosen Titel der Zwischenüberschrift trägt, und der von Dr. Fritz Lehner verfasst wurde. Über den Herren kann nicht viel mehr berichtet werden, als dass er sich mit französischer Literatur befasste. Ein weiterer Artikel in einer Ausgabe der Zeitschrift »Deutsch-Französische Rundschau« aus dem Jahr 1931 deutet darauf hin.
In dem Beitrag wird ein Blick auf die französischsprachige Kriminalliteratur der damaligen Zeit geworfen. Dabei wird auch sehr ausführlich auf Georges Simenon eingegangen, vermutlich erstmalig in der deutschsprachigen Presse – jenseits von Home Storys. Der erste Teil ist der allgemeinen Betrachtung gewidmet, die sich nach Lehner von den englischen und amerikanischen Krimis emanzipiert hatte. Allerdings war das meiste nur Durchschnitt und würde den üblichen Konventionen folgen. Hier lässt sich gewiss darüber streiten, ob dies eine andere Bezeichnung für »langweilig« ist.
Dann kommt er zu den Ausnahmen: Leblanc und sein Meisterverbrecher Arsène Lupin läge über dem Durchschnitt. Und dem folgt:
In der letzten Zeit zitiert man gern Georges Simenon; auch bedeutende Literaturkritiker springen für ihn ein. Was Simenon vor den Engländern auszeichnet, ist weniger die Belastung seiner Romane mit Psychologie, als die packende Wiedergabe der Atmosphäre, in der das Verbrechen sich abgespielt hat. Psychologie ist am landläufigsten Kriminalroman nicht sehr beliebt; sie beschwert die Handlung und regt dort zum Nachdenken an, wo über die Ereignisse schnell hinweggegangen werden soll. Hier aber wird die Stimmung vom Atmosphärischen her so stark hergestellt, dass schon deshalb die Handlung nicht schleppt. Und außerdem werden wir nicht ständig irregeführt, wie das sonst üblich ist, wir sind in die Klugheit des Autors mit eingeschlossen, und irren uns nur dort, wo auch Herr Maigret, der Sherlock Holmes dieser Romane, sich täuscht.
Als Beispiel wird von Lehner der Roman »L'ombre chinoise« angeführt, der zu dem Zeitpunkt in deutscher Sprache nicht erschienen war. Das Werk Simenons wird von dem Autor mit dem von Dostojewski verglichen.
Wenn das nicht mal ein sehr guter Einstand in das deutschsprachige Feuilleton war.
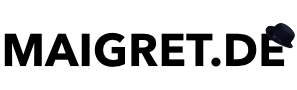

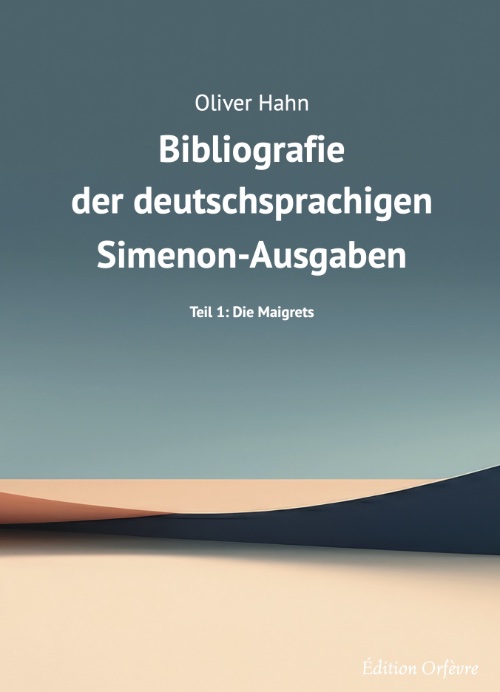 Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.
Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.

